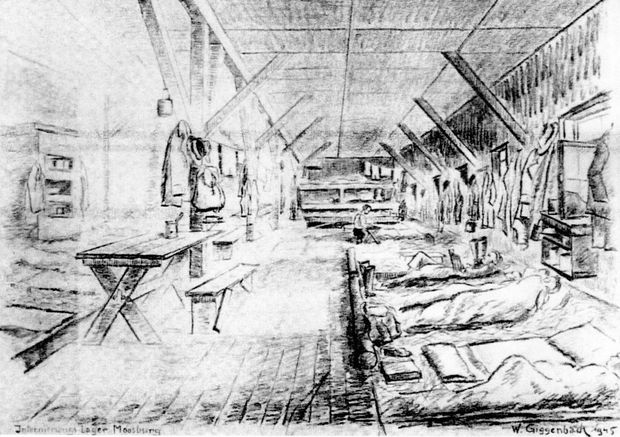Organisieren hilft
Die Suche nach Essen
Die Rollen sind vertauscht. Während die einen, die früher nichts hatten, nun erheblich besser versorgt werden, geht es den anderen, die zu Kriegszeiten nie am Hungertuch nagten, nun schlecht.
Die einen, das sind die ehemaligen, jüdischen KZ-Häftlinge, die nun im Lager Föhrenwald wohnen und von der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, der UNRRA, versorgt werden.
Die anderen, das sind die Menschen in Wolfratshausen, die in den Jahren 1945 und 1946 nur mit viel Mühe und großem Aufwand genug Essen zum Überleben organisieren können.
Organisieren, das ist jeden Tag aufs Neue eine Notwendigkeit. Eine heute 70-jährige Wolfratshauserin erinnert sich: "Wir haben von morgens bis abends nur organisiert - geschaut, wo wir etwas zum Essen herbekamen."
Das System der Lebensmittelmarken, von den Nazis im Krieg eingeführt, wird von den amerikanischen Besatzern übernommen. Allerdings ist Nahrung nun noch knapper, die Rationen für den Einzelnen werden ständig heruntergesetzt.
Bis zum Skelett abgemagert
Andreas Stumpf berichtet: "Die zugeteilten Lebensmittel reichten bei weitem nicht aus. Manche Leute sind bis zum Skelett abgemagert; andere bekamen wegen ungenügender Ernährung geschwollene Füße. Es war zu beobachten, wie die Leute warteten, bis die Abfalltonnen aus den von den Amerikanern besetzten Häusern zum Abtransport auf die Straße gestellt wurde. Die Leute sind darüber hergefallen und haben aus dem Unrat alles noch einigermaßen Eßbare herausgesucht. Die Sterblichkeit war nach dem Krieg sehr groß."
Der absolute Tiefststand wird in der 103. Zuteilungsperiode 1946 erreicht. Jedem Erwachsenen stehen täglich noch 200 Gramm Brot, 13 Gramm Fleisch, 5 Gramm Fett, 28 Gramm Nährmittel, 4 Gramm Käse, 17 Gramm Zucker und 333 Gramm Kartoffeln zu.
Bei solchen Rationen wird Überleben zum Problem. Kein Wunder, dass schon einige Monate ein mit Galgenhumor gesegneter Zeitgenosse über dem Portal des Nantweiner Friedhofs ein Schild anbrachte: "Eingang zur 100. Kartenperiode".
Dank der Hilfslieferungen aus den USA gibt es beim "Judenmarkt" in Föhrenwald fast alles zu kaufen.
Judenmarkt im Föhrenwald
Wohl dem, der da Tauschware oder auch noch Geld hat, um sich auf dem Schwarzmarkt zu versorgen.
Allwöchentlich sonntags pilgern die Wolfratshauser zu Fuß zum so genannten "Judenmarkt" auf der Wiese am Eingang zum Lager Föhrenwald (dort, wo heute das Umspannwerk der Isar-Amperwerke in Waldram steht).
Hier gilt die Regel: Ware gegen Lebensmittel, Ware gegen Geld. Die Rede ist von "Kompensationsgeschäften". Die begehrten Ami-Zigaretten, "Lucky Strike", "Marlboro" und wie sie alle heißen, sind so gut wie Geld.
Allerdings kostet eine Schachtel Zigaretten auf dem "Judenmarkt" 80 Reichsmark, für eine Tafel Schokolade sind 30 Mark zu bezahlen, ein Pfund Kakao kostet 180 Mark, die gleiche Menge Bohnenkaffee sogar 300 Mark. Und selbst ein halbes Kilo Zucker (er bleibt noch bis März 1950 rationiert) ist für nicht weniger als 100 Reichsmark zu haben.
Daß es den Bewohnern des für heimatlose Ausländer (Displaced Persons oder DPs) reservierten Lagers Föhrenwald besser geht als der Bevölkerung rundherum, hat seinen Grund. Die Militärregierung und natürlich die Öffentlichkeit im fernen Amerika, steht unter dem Schock des Holocaust, der nur langsam in allen seinen Ausmaßen bekannt wird.
Die DP-Lager - Föhrenwald ist das größte in der amerikanischen Besatzungszone - werden daher vorrangig versorgt.
Die oben bereits zitierte 70-Jährige: "Die Leute haben waggonweise Kleidung bekommen - direkt aus Amerika. Nur, vielen Juden, die nun schon wohlgenährt waren, passten die eleganten, eng geschnittenen Sachen nicht mehr. Wir hingegen waren alle dürr, halb verhungert."
Schon für 10 Reichsmark ist auf dem Markt ein Wintermantel zu haben - vorausgesetzt, man kann geschickt handeln."
Kaninchenzüchterland
Aber wer kann, versorgt sich selber. Fast jeder Wolfratshauser hat ein kleines Stück Garten - genug Platz vor allem für die Kaninchenhaltung. "Wolfratshausen ist ein Kaninchenzüchterland", sagt eine Zeitzeugin.
40 Langohren in einem Haushalt sind keine Seltenheit - alle 14 Tage wird ein Kaninchen geschlachtet. Bevorzugt wird die
an Fleisch reiche Rasse "Belgischer Riese". Alles wird verwertet: Die Felle werden zu Handschuhen, Pelzwesten und Kniewärmern verarbeitet.
Solche Möglichkeiten haben die Bewohner von München, der einstigen "Hauptstadt der Bewegung" nicht. Sie kommen allerdings in Scharen zum Hamstern aufs Land. Werden sie dabei von der Polizei erwischt, dann haben sie schlimme Strafen zu befürchten. Landrat Hans Thiemo in einem Aufruf: "Bauern! Weist Hamsterern die Türe!"
Natürlich nutzen die Wolfratshauser auch das, was die Wälder rundherum hergeben. Die 70-jährige Wolfratshauserin: "Wir sind Bucheckern sammeln gegangen. Zwei Zentner haben wir zusammenbekommen." Die werden dann am Forstamt eingetauscht - gegen Fett.
Das nämlich ist wie schon im Krieg absolute Mangelware. Vor allem die Milcherzeugung wird bei den Bauern streng überwacht, die Milch muss fast komplett abgeliefert werden.
Landrat Thiemo: "In Anbetracht der Ernährungslage unseres Volkes, und hier wiederum im besonderen der Stadtbewohner und deren Kinder, muss jedoch verlangt werden, dass der Milchverbrauch im Hause eingeschränkt wird. 1 Liter pro Haushaltsangehörigen in der Hauptarbeitszeit muss ausreichend sein."
Trotz dieser Vorschriften und der Überwachung geht die (offizielle) Milchproduktion im Landkreis im Sommer 1945 drastisch zurück - um bis zu 38 Prozent im Vergleich zum Kriegsjahr 1944.
Amerikaner verbrennen Essen
Von den amerikanischen Besatzern ist in den ersten Monaten nicht viel zu erwarten. Natürlich wollen sie niemanden verhungern lassen, aber sie geben auch nicht mehr Lebensmittel her, als unbedingt sein muss.
Eine Frau, deren Wohnung beschlagnahmt wurde, erinnert sich: "Hinten im Garten haben die Leute ein großes Loch gegraben. Da haben sie ihre überzähligen Lebensmittel reingeworfen, Benzin drübergegossen und das Ganze dann angezündet."
Allerdings kann man auch Glück haben - zum Beispiel das, an einen farbigen Soldaten zu geraten. "Die Neger waren sehr kinderfreundlich. Die haben immer was gegeben."
Oder man hat Glück und stößt zufällig auf ein Lebensmittel-Lager, wie es der schon genannten Wolfratshauserin passiert: "Wir waren in der Gegend von Meillenberg beim Schwammerlsuchen, da stieß ich im Wald plötzlich auf einen großen Haufen Lebensmittel, Dosen mit Bratenfett, Berge von Keksen, Fleischkonserven. Ich holte sofort meine Familie, und wir transportierten alles nach Hause. Zwei Jahre haben wir daran gegessen."
Auch wenn die Bauern alles abliefern müssen, gibt es doch auf so manchem Hof Arbeit für Hilfskräfte. "Den ganzen Sommer 1946 war ich auf Gut Buchberg im Einsatz. Dort wurden Kartoffeln und anderes Gemüse angebaut. Für einen halben Tag Arbeit gab's einen Eimer Kartoffeln, das waren mehr als zehn Kilo. Magermilch wurde ebenfalls verteilt."
Die Kartoffeln werden zum Tauschgut: Bei Metzgern und Bäckern gibt's dafür Fleisch und Brot. Doch auch die Fleischer stehen unter strenger Kontrolle. Wer bei Schwarzschlachtungen erwischt wird, wandert ins Gefängnis. Fünf von ihnen werden erwischt und bestraft. Sie hatten jenseits der Isar Rinder gekauft, um sie in Wolfratshausen zu schlachten.
Keine Angst vor der Strafe
Die Hemmschwelle vor Gesetzesübertretungen ist gering. Eine Wolfratshauserin: "Es ging schließlich ums Überleben."
Im Bereich Höhenrain werden im Oktober 1945 neun Bienenvölker gestohlen. Der "Loisach-Isar-Bote": "Es kann leider noch nicht damit gerechnet werden, daß die Kette der Einbrüche abreißt. Im Gegenteil muss den Winter über mit einer Zunahme solcher Schandtaten gerechnet werden.
Darum empfiehlt es sich, Selbstschutz zu betreiben. Was von amtlicher Seite geschehen kann (Telefon, Landpolizei), wird geschehen, aber es kann nicht überall zugleich wirksam geholfen werden."
Kartoffelkäfer kommt
Nach den Amerikanern kommt der Kartoffelkäfer. Schon am 26. Mai 1945 schickt der frischernannte Landrat Hans Thiemo eine erste Brandmeldung an alle Bürgermeister heraus, dass dem "Kartoffelkäfer, der bereits in Kochel, Dorfen und Baierbrunn einwandfrei festgestellt wurde, besondere Aufmerksamkeit zu widmen" sei.
Die Bürgermeister werden aufgefordert, einen Suchdienst aufzustellen "und im Falle der Entdeckung von Kartoffelkäfern sofort Gasarol-Stäubung bei der Landwirtschaftsstelle Wolfratshausen zu beantragen."
Vor allem Kinder werden für den Kartoffelkäfer-Suchdienst eingesetzt. Landrat Thiemo: "Wer sich drückt, darf hinfort
keine Lebensmittelkarten mehr erhalten." Einen Monat später, Ende Juni, wird flächendeckend Gift gegen den Kartoffelkäfer gespritzt.
Wie wichtig die Kartoffel als Grundnahrungsmittel ist, geht aus einer Reihe von behördlichen Erlassen hervor: So ist es auch "streng verboten, Kartoffeln - selbst in kleinen Mengen - nach München zu liefern".
Wolfratshauser "Fischköpfe"
"Fischköpfe", so heißen die norddeutschen Küstenbewohner landläufig. Fischköpfe sind in der Notzeit nach Kriegsende auch die Wolfratshauser: Ein ganzer Waggon voller Schollen wird der Marktgemeinde einmal wöchentlich zugeteilt - aus Hamburg und aus Bremerhaven.
Allerdings weiß zuerst niemand, wie die Seefische auszunehmen und zuzubereiten sind. Erst nach längerer Suche findet sich ein Ehepaar, das aus Hamburg stammt, und die Wolfratshauser in die Kunst des Fischkochens einweist.
Organisiert werden die Transporte vom Ernährungsamt in der Sauerlacher Straße. Per Lastwagen werden jeweils zehn bis 15 Tonnen in München in der Arnulfstraße abgeholt. Schon ab 4 Uhr früh am Verteilungstag warten hungrige Menschen auf die Delikatesse, obwohl die Ausgabe erst ab 7 Uhr erfolgt.
"Jeder hat was bekommen", erinnert sich Anton Geiger, der für die Verteilung zuständig war. "Sechs bis sieben Leute waren den ganzen Tag mit der Ausgabe der Fische beschäftigt. Eine Kühlung gab es nicht. Man hat halt gerochen, ob die Fische gut sind."
Passierscheine und Fahrradkarten
Strenge Reglementierung erfahren die Wolfratshauser nicht nur bei der Zuteilung von Lebensmitteln. Auch freies Reisen
ist nicht möglich - nur innerhalb des Landkreises. Dafür werden Passierkarten von der Militärregierung ausgestellt.
Neben der Unterschrift, der Adresse und einer Nummer enthalten sie auch einen Fingerabdruck. Sie erlauben aber kein Verlassen des Landkreises. Selbst für "Reisen nach München" gelten strenge Vorschriften.
Sie sind nur Leuten erlaubt, die dort ihr Geschäft wiedereröffnen wollen, außerdem Geistlichen, Ärzten, Elektroarbeitern, Lebensmittelhändlern, Bürgermeister, Angehörigen der Polizei und der Feuerwehr sowie Kranken, die zum Arzt müssen - "jedoch nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad".
Passierscheine werden auch für Radl ausgestellt: Sie sind in der Nachkriegszeit in Wolfratshausen purer Luxus.
Wegen des Mangels an Gummi gibt es Reifen nur auf Bezugsschein und nur für solche Leute, deren Arbeitsstätte mindestens 3,5 Kilometer entfernt ist. Jugendlichen ist im November 1945 das Radfahren ganz untersagt. Und wer ohne Registrierkarte erwischt wird, dessen Fahrrad wird beschlagnahmt.
Lauter Lügen
Ein nazifreies Wolfratshausen
Wolfratshausen soll "nazifrei" werden, die ehemaligen Nationalsozialisten für ihre Unrechtstaten, für ihren Irrglauben bestraft werden. Dies ist eines der vorrangigen Ziele, das die amerikanische Militärregierung auch in Wolfratshausen verfolgt.
Und es wird mit großer Härte durchgegriffen: All jene, die Führungspositionen in der NSDAP oder ihren Untergliederungen wie SA und SS hatten, werden ohne weitere Verfahren, ohne Prüfung von Schuld oder Unschuld in "automatischen Arrest" genommen. Sie schmoren teilweise zwei Jahre und länger in Internierungslagern.
Nazis aus Behörden entfernt
Aber auch den Nazi-Mitläufern, den Parteigenossen (PGs), soll es an den Kragen gehen, soll ... Landrat Hans Thiemo am 5. Juni 1945: "Wer der Nazipartei angehörte, scheidet aus allen öffentlichen Ämtern. Die Bürgermeister melden diese Leute, für ihre Entfernung sorgt der Landrat."
Diese Anordnung vergrößert das durch den Zusammenbruch des Dritten Reichs entstandene Chaos noch: Auch in Wolfratshausen gibt es kaum einen Beamten, kaum einen gemeindlichen Angestellten, kaum einen Lehrer, der nicht Parteigenosse war.
Ohne Mitgliedschaft in der NSDAP war niemand befördert worden, im Gegenteil, manche wie der einstige Gemeindeschreiber, der Sozialdemokrat Franz Geiger, wurden sogar zwangspensioniert. Und deshalb gibt es im Mai 1945 nach der "Säuberung" in den Behörden auch fast keine Mitarbeiter mehr.
Auch die Wolfratshauser Firmenchefs, die oft besserer Geschäfte wegen, der Partei beigetreten waren, werden bestraft. Ihre Unternehmen sind Treuhändern unterstellt. In nicht wenigen Fällen nutzen diese ihre Stellung zur persönlichen Bereicherung. Eine Geschäftsfrau erinnert sich: "Als wir unseren Laden wieder zurückbekamen, war alles weg, sämtliche Ware und sämtliche Möbel."
Wohnungsfrage auf Kosten der Nazis
Der von den Amerikanern eingesetzte Tölzer Landrat Anton Wiedemann, ein Seifenfabrikant, schreibt in seiner Chronik "Bewegte Jahre": "(...) mussten sämtliche im Landkreis vorhandenen Betriebe und die Angehörigen der freien Berufe registriert werden, da ohne die Genehmigung der Militärregierung keine Tätigkeit ausgeübt werden durfte.
Soweit der Geschäftsinhaber aktiv in der Partei tätig war, wurden unbelastete Angestellte zur Fortführung des Betriebes,
in vielen Fällen auch Treuhänder bestellt, die sich aber häufig als ungeeignet erwiesen und ihre eigenen Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund stellten."
Die ehemaligen Parteigenossen bekommen in jeder Weise den Zorn der neuen Machthaber zu spüren. Flüchtlinge, Evakuierte und andere Obdachlose, sie werden vorrangig in Häusern ehemaliger Nazis einquartiert.
Landrat Thiemo am 3. November 1945: "Der kommenden Winternot steuere man jetzt schon durch vorbeugende Maßnahmen entgegen. Unhaltbare Wohnverhältnisse sind schleunigst zu regeln. Die Wohnungsfrage muss überall auf Kosten der Nazi geregelt werden. Diese sind in ihrem Wohnraum weitgehend zu beschränken und zur Aufnahme besonders norddeutscher Flüchtlinge zu zwingen."
Heimkehrer: Toni Hölzl (Mi.) kehrte im Herbst 1945 aus der Kriegsgefangenschaft heim -
zur Freude seines Bruder Josef und seiner Mutter Anna.
"Wenn ich mit ihm ginge..."
Den Eigentümern bleibt meist für die ganze Familie nur ein Raum. Und manchmal nicht mal der. Die Geschäftsfrau:
"Irgendwann kam eine junge Frau zu uns. Sie war schwanger - von einem Amerikaner - und sagte, sie müsse nun hier wohnen. Aber wir hatten nur einen Raum, meine Mutter, meine Schwester und ich. Da warf sie ein Nachbar kurzerhand wieder raus. Sie kam nie wieder."
Die damals 17jährige schüttelt sich noch heute, wenn sie an einen anderen Vorfall denkt: "Wir müssen sofort das Haus verlassen, sagte uns der Leiter des Wohnungsamts, ein Mann namens Kraft. Dann schaute er mich an und sagte, aber wenn ich mit ihm ginge, dann ließe sich vielleicht noch einmal über die Zwangsräumung reden." Die junge Frau ging nicht mit.
Die Strafen der amerikanischen Militärregierung aber reichen noch weiter: Ehemaligen Parteimitgliedern wird die Arbeit verboten. Lediglich zu Hilfsdiensten dürfen sie noch eingesetzt werden - zugeteilt werden ihnen diese Stellen vom Arbeitsamt.
Und auch die ohnehin kargen Lebensmittelrationen sollen gekürzt werden. Ein Loch kennzeichnet die Zuteilungskarte eines Nazis, damit gibt's nur halbe Mengen. "Diese Regelung kam aber nicht zum Tragen", erinnert sich eine heute 70jährige Wolfratshauserin und einstige PG: "Als die Männer in den Internierungslagern nur halbe Rationen bekamen, sahen sie nach kurzer Zeit aus wie KZ-Häftlinge. Daraufhin wurde die Lochung der Lebensmittelkarten wieder fallen gelassen."
Nazis wieder frech?
Am Zorn auf die ehemaligen Parteigenossen ändert sich dadurch nichts. Landrat Hans Thiemo am 9. August 1945: "Es ist darauf zu schauen, dass die Nazi, die wieder anfangen, frech zu werden, keinen Schwung bekommen, damit uns keine Unannehmlichkeiten mit den Amerikanern entstehen. Kein Bürgermeister darf, wie die Dinge zur Zeit liegen, einen Nazi einem Nichtnazi vorziehen."
Das betrifft auch Spendenzahlungen für Notleidende. Am 28. Juni 1945 schreibt das Amtsblatt der Militärregierung, der Loisach-Isar-Bote: "Durch eine Geldsammlung des Landrats bei einigen alten oder stärker hervorgetretenen ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei stehen nunmehr zur Unterstützung völlig mittellos gewordener Flüchtlinge (...) Mittel zur Verfügung, die es erlauben, drückende und entwürdigende Not zu beheben. (...) Der Maßstab der Gerechtigkeit ist dabei anzuwenden und alles zu unterlassen, was als persönliche Rache ausgelegt werden könnte. Die neuen Männer sind keine Nazi, sie verschmähen es, an Wehrlosen Rache zu üben."
Betten für Lager Föhrenwald
"Nazifamilien, auch Einzelpersonen" werden von der amerikanischen Militärregierung im Dezember 1945 herangezogen,
um Inventar für das DP-Lager Föhrenwald zu beschlagnahmen. Benötigt werden 1000 Federbetten, 500 Stühle und Bänke, 350 Bettstellen, 30 Kinderbadewannen, 30 Wiegen oder Kinderwagen, 3 Uhren und eine Schulglocke.
Jede Gemeinde im Landkreis hat ein bestimmtes Kontingent zu erfüllen, Wolfratshausen muss unter anderem 66 Bettstellen und 159 Federbetten abliefern. Herangezogen werden neben ehemaligen Parteigenossen auch "Personen, die sich gegenüber Opfern und Gegnern des Nationalsozialismus gehässig verhalten haben, insbesondere "Denunzianten", und "alle Personen, die sich an der Auflösung des Wolfratshauser Judenheims (das ehemalige Mädchenpensionat, d. Autor) beteiligt haben".
Streng ist die Militärregierung auch mit all jenen, die sich negativ über sie äußern. So wird Alfred B. aus Baierbrunn
im Februar 1946 zu sechs Monaten Gefängnis "wegen unfreundlichem und respektlosem Verhaltens gegenüber Angehörigen der Vereinten Nationen" verurteilt.
Im alten Schulhaus wird 1947 eine Synagoge eröffnet (v. li.): Pfarrer Otto Schneller,
Dr. Spanier, Dr. Auerbach, US-Leutnant Gennen und Herr Nadelski.
Entnazifizierung: 400 PGs.
"Ja,Wolfratshausen, das waren doch fast alles Nazis", so erinnert sich ein heute fast 80jähriger Stadtbürger. "Fast alles Nazis", das mag übertrieben sein, ganz falsch ist es nicht: Über 400 der knapp 3000 Einwohner der Marktgemeinde sind am 1. Mai 1945 als Parteimitglieder eingetragen, fast jede Familie ist in der NSDAP vertreten. Und es gibt genug, die auch zu Kriegsende noch Feuer und Flamme für Hitler sind und den Einmarsch der Amerikaner nicht als Befreiung, sondern als Niederlage empfinden.
Der Entnazifizierung entgeht kein Parteigenosse - allerdings trifft sie nicht alle gleich hart. Der Nachbar will auch in Zukunft mit dem Nachbarn noch Tür an Tür leben können, also schützt man sich gegenseitig. Und dennoch wird das Mittel der (in der Regel anonymen) Denunzierung, im Hitler-Staat stets gefördert, auch nach dem Krieg gerne genutzt, um missliebigen Nachbarn der Bekannten zu schaden.
Der Tölzer Landrat Anton Wiedemann blickt 1955 auf die Verhältnisse in seinem Landkreis zurück: "Minderwertige Elemente gingen täglich bei der Militärregierung ein und aus, meist in dem Bestreben, anständige Leute zu denunzieren und in der Absicht, sich selbst Vorteile zu verschaffen. (...)
Manche dieser Besucher gefielen sich in der Rolle eines politisch Verfolgten und eine nicht geringe Zahl, die noch vor kurzer Zeit der Parole des Dritten Reichs gefolgt war, suchte sich nun bei den Amerikanern lieb Kind zu machen."
Urteile der Spruchkammer
Gleiches gilt für Wolfratshausen. Der hier stationierte amerikanische Untersuchungs-Offizier Ludwig Scheithauer:
"Gelogen wurde eine ganze Menge. Es hat bloß keinem genutzt. Wir hatten sogar die Parteinummern und Eintrittsdaten der Genossen."
Im März 1946 wird es ernst: Das "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus", die Grundlage für die Entnazifizierung, wird erlassen, in Wolfratshausen von der Militärregierung eine Spruchkammer gebildet.
Der Vorsitzende ist Friedrich Hesselbarth aus Wolfratshausen, zweiter Mann im Amtsgericht, nie Parteigenosse, ein gläubiger Protestant. Sein Stellvertreter ist Hans Rudolf Rothmüller. Der Ankläger heißt Alois Schuster. Er stammt aus Freilassing und ist einer der Mitbegründer der SPD Wolfratshausen, Stellvertreter ist Andreas Paul Schmidt.
Die erste Verhandlung findet am Sonntag, 19. Mai 1946 im Rathaus statt. Die Sitzungen sind öffentlich und anfangs noch
eine willkommene Abwechslung für die Bürger. Aber sehr bald verliert sich das Interesse der Leute, außer den Angehörigen der Betroffenen besucht kaum noch jemand die Verhandlungen. Die Menschen haben andere Sorgen.
Ist der Ankläger korrupt?
Der Aufwand für die Entnazifizierung ist indes enorm. Jeder Parteigenosse hat einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen, in Wolfratshausen spricht man vom "Handtuch". Die Parteigenossen suchen sich Entlastungszeugen, die für sie eintreten. Dies dürfen allerdings nur Mitbürger sein, die nie Mitglied der NSDAP waren.
Über die Ernsthaftigkeit der Spruchkammer-Arbeit lässt sich noch heute, 50 Jahre später, trefflich streiten. Eine 70-jährige Wolfratshauserin empört, wenn sie über Ankläger Schuster spricht: "Der war doch korrupt. Wer vermögend war und etwas anzubieten hatte, der bekam einen 'Persilschein', der wurde freigesprochen." Angeblich muss Schuster später unfreiwillig Wolfratshausen verlassen.
Fünf Stufen der "Schuld" sieht das Entnazifizierungs-Gesetz vor: Aktivist (solche sitzen bereits im Internierungslager), Nutznießer, Bewährungsgruppe, Mitläufer und Entlasteter (Parteimitglied, aber im Widerstand).
In die Gruppe der Mitläufer fallen die meisten - sie bekommen eine Geldstrafe aufgebrummt, in der Regel ein paar hundert Mark, die als Wiedergutmachung zu zahlen sind. Die Minderbelasteten, die sich bewähren sollen, müssen erheblich mehr bezahlen. Sie werden außerdem in der Ausübung ihres Berufs erheblich eingeschränkt.
Nochmal Anton Wiedemann: "Durch die Entnazifizierung wurde in die Bevölkerung eine große Kluft hinein getragen, da sich die Maßnahmen nicht auf die Bestrafung von wirklich Schuldigen beschränkte, sondern auch viele einwandfreie Persönlichkeiten, die wirklich nur in guter Absicht und nur dem Namen nach der Partei beigetreten waren, mit härtesten Maßnahmen belegt wurden." Diese Kluft ist übrigens noch heute, nach 50 Jahren, spürbar bei Gesprächen mit älteren Wolfratshauser Bürgern.
Einst wurde hier an der Wolfratshauser Zukunft geplant: In der gleichnamigen
Gastwirtschaft am Obermarkt traf sich die "Löwenbräu-Regierung".
Die "Löwenbräu-Regierung"
Eine zwielichtige Rolle spielt die sogenannte "Löwenbräu-Regierung". In der Wirtschaft von Josef Schwaiger, beziehungsweise in dessen Wohnzimmer, treffen sich schon während des Krieges prominente Wolfratshauser in aller Heimlichkeit - um "Feindsender" zu hören.
Nach der Befreiung wollen diese Männer - aus der Runde geht später auch die CSU hervor - ihren Teil zur zukünftigen Demokratie beitragen. Das hat zum Teil kuriose Folgen: So werden arbeitslose Akademiker aufgefordert, sich in drei Tagen zum Lehrer ausbilden zu lassen. Es gibt auch hier einen Mangel: Die meisten Pädagogen wurden gefeuert, weil sie Parteimitglied waren. Nach dem dreitägigen Crash-Kurs ist allerdings kaum einer der frischgebackenen Lehrer in der Lage, eine Klasse zu führen. "Da ist's zugegangen wie bei den Wahnsinnigen", erinnert sich eine Wolfratshauserin.
Das Wort von der "Löwenbräu-Regierung" macht im Ort die Runde - manche Leute fühlen sich diskriminiert. "Das waren Geschäftsleute, Männer vom Kirchenchor und die haben auch darüber beraten, wer nun als Nazi verfolgt werden soll und wer nicht."
Eine andere Zeitzeugin kann sich an solche Debatten nicht erinnern: "Die haben sich über die Zukunft Wolfratshausens unterhalten. Entnazifizierung war gewiss nicht ihr Thema."
Noch bis 1948 dauert die Arbeit der Spruchkammern. Friedrich Hesselbarth ist nicht bis zum Ende der Vorsitzende.
Er wird von einem Unbekannten bei den Amerikanern angezeigt: Er habe Urkunden gefälscht. Liselotte Kaufmann,
die Tochter des 1962 verstorbenen, im Mai 1995:
"Mein Vater war Amtsanwalt am Amtsgericht Wolfratshausen und nie Mitglied der NSDAP. Die amerikanische Militärregierung berief ihn 1946 gegen seinen Willen zum Vorsitzenden der Spruchkammer. Als solcher wurde er von einer mir bekannten Person denunziert, mit der Behauptung, er habe seine eigenen Papiere gefälscht.
Die Amerikaner verhafteten ihn. Er saß monatelang im Gefängnis. Gegen eine Kaution von 10000 Mark wurde er freigelassen, nachdem sich auch einige Prominente für ihn eingesetzt hatten. Bei der späteren Gerichtsverhandlung hat man ihn als Ehrenmann voll rehabilitiert. Das Unrecht, eingesperrt worden zu sein, hat er allerdings nie verwunden."
Eine andere Zeitzeugin: "Das war ein feiner Denunziantenverein."
34 Zeugen wegen eines "Mitläufers"
Leise Andeutungen genügen schon, um auch unbescholtene Bürger in die Fänge der amerikanischen Militärjustiz geraten zu lassen. Eines der Opfer solcher Denunziationen ist Andreas Stumpf, Gründer und Chef des Wolfratshauser Fruchtsaftproduzenten "Wolfra".
Ein ehemaliger Vorarbeiter von ihm zeigt ihn bei der Militärregierung und verschiedenen bayerischen Ministerien an, Stumpf habe die Fremdarbeiter während des Kriegs schlecht behandelt, ein kroatischer Arbeiter sei auf Veranlassung des Unternehmers hin von der Gestapo verhaftet und ermordet worden. Stumpf widerspricht: "Wir waren überall dafür bekannt, dass wir die Leute gut behandelt haben."
Zehn verschiedene Behörden laden den "Wolfra"-Chef zu Vernehmungen vor, darunter sogar die Oberste Entnazifizierungsstelle in München. Deren Leiter Dr. Hartmann zu Stumpf: "Sind Sie froh, dass keine Anzeige von Ausländern gegen Sie vorliegt, die Anzeigen Deutscher werden nicht bewertet."
Trotzdem muss Stumpf auch vor dem amerikanischen CIC, einer Untersuchungsbehörde, aussagen: "Von dieser wurde man in der Regel festgenommen und nicht mehr freigelassen." Erst nach vier Verhören kann Stumpf die CIC-Leute davon überzeugen, dass die Vorwürfe falsch sind. Der Vorsitzende: "Was seid Ihr Deutsche nur für Leute, dass Ihr Euch gegenseitig umzubringen versucht?"
Mehrere hochrangige Unternehmer machen sich für Stumpf stark. In einem Schreiben an die Militärregierung heißt es:
"Ich versichere Ihnen, dass sowohl die Herren des Caritas-Verbandes wie ich selbst (...) Herrn Stumpf als durch und durch anständigen, ehrlichen, einfachen Menschen (...) kennen und schätzen gelernt haben. (...) Dieser Vorgang zeigt deutlich die ganze Hinterhältigkeit der Denunziation."
Der Bischof setzt sich ein
Der Bischof von Ermland/Ostpreußen schickt ein Entlastungsschreiben und auch die Wolfratshauserin Katharina Manhart: "Herr Stumpf wurde wegen seiner Einstellung zur NSDAP wiederholt bedroht. (...) Seine gegnerische Einstellung kam auch durch Unterstützung jüdischer Familien zum Ausdruck. Die Familie Spatz aus Wolfratshausen wurde bis zum Jahre 1940, das war zu einer Zeit, in der die Waren beschlagnahmt waren, noch durch Lieferungen unterstützt."
Erst das Polizeipräsidium stellt dann fest, dass an den Vorwürfen des ehemaligen Vorarbeiters nichts dran ist. Der Denunziant wird verhaftet.
Stumpfs Probleme sind allerdings mit der Rehabilitierung noch nicht beendet. Sein Betrieb wird von einem "Treuhänder" verwaltet. Stumpf darf die "Wolfra" nicht betreten. Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um seine Firma wieder zurückzubekommen. Es dauert aber wiederum Monate, bis Stumpf im Chefsessel Platz nehmen darf.
Kriegsgewinnler - Nadelskis
Das Treuhänder-Unwesen, das auch Andeas Stumpf zu spüren bekommt, hat auch viele andere Wolfratshauser Geschäftsleute im Griff. Zu den besonderen Günstlingen gehören die Gebrüder Nadelski. Woher die beiden angeblich jüdischen Geschäftsleute gekommen sind, liegt genauso im Dunkeln, wie ihr plötzliches Verschwinden.
Die Militärregierung setzt die Nadelskis in mehreren Betrieben als Treuhänder ein. Als die Inhaber ihre Firmen wieder übernehmen dürfen, stehen sie im Chaos. Bei einem Wolfratshauser Eisenwarenhändler räumt einer der Nadelskis das gesamte Lager aus und schafft die Sachen zu seiner Geliebten.
Nachgesagt wird den beiden auch die Denunzierung prominenter Wolfratshauser Bürger, unter anderem des Spruchkammer-Vorsitzenden Friedrich Hesselbarth.
Einen anderen Wolfratshauser, den ehemaligen NS-Funktionär Max B., haben sie allerdings vor dem Internierungslager bewahrt. Sie benötigten den ehemaligen Finanzbeamten, so erzählt seine Witwe, in einem der von ihnen treuhänderisch verwalteten Betriebe als Buchhalter.
Das Grauen in Camp No. 6
Anton S., SS-Unterscharführer
Aus heutiger Sicht ist es schwer zu verstehen, warum jemand schon vor der Machtübernahme Hitlers freiwillig einer Partei wie der NSDAP beigetreten ist - um damit natürlich auch deren unmenschliche Ziele wie Judenvernichtung, Euthanasie und Kriegstreiberei mitzutragen. Schwer nachvollziehbar ist 50, 60 Jahre später allerdings auch, welche beruflichen und persönlichen Nachteile jene hatten, die sich aus Prinzip weigerten, in die Partei zu gehen.
Einer der vielen Wolfratshauser, die um ihres Geschäfts willen den leichten Weg, den innerhalb der Partei, gegangen sind, war Anton S. (Name ist auf Wunsch der Nachkommen geändert). Er musste für seine Stellung als SS-Offizier schwer büßen: 30 Monate saß er ab Mai 1945 unter schwierigsten Bedingungen in verschiedenen Internierungslagern ein.
Die Geschichte von Anton S. soll hier anhand von dessen Aufzeichnungen und von Briefen erzählt werden. Es ist die Geschichte einer persönlichen Tragödie, die Geschichte eines Mannes, der sich als Funktionär eines menschenverachtenen Regimes schuldig gemacht hat - ohne tatsächlich selber Verbrechen begangen zu haben.
Geschäfte mit der Partei?
Bereits am 1. August 1932 tritt S. in die Partei ein, "aus rein ideelen Gründen", wie er später schreibt. Er glaubt, dass nur "eine große Arbeiterpartei die wirtschaftliche Notlage beheben und die große Arbeitslosigkeit beseitigen" kann.
Zudem hat der Ladeninhaber hohe Schulden, die er durch Geschäfte mit der Partei schneller tilgen zu können glaubt.
Nach der Machtübernahme Hitlers tritt S. im März 1933 der Reserve der SA bei: "Wie bekannt, war in der SA-R wenig Dienst, bei Geschäftsverhinderung konnte man auch wegbleiben." Anton S. wird zum Gemeinderat ernannt. Er findet heraus, dass sein SA- und Gemeinderats-Kollege T. sich bestechen ließ.
Er zeigt T. an, verlangt dessen Entlassung. Ein schmutziges Spiel beginnt. Der SA-Sturmführer verlangt von S., dass er sich bei T. entschuldigt. S. weigert sich, deshalb wird er von der SA ausgeschlossen. Auch den Gemeinderat muss er verlassen - der vorgeschobene Grund lautet "Judenfreundlichkeit".
Tatsache ist: Er wurde denunziert, weil er den Juden Hermann Spatz, einen alten Freund, im Fasching 1934 im Gastzimmer des Humplbräu umarmt hatte (siehe auch Seite 22). Der Ausschluss aus der Partei droht - S. fürchtet, wirtschaftlich ruiniert zu sein. Er tritt der SS bei.
Mitglied von SS und Gesellenverein
Da der Sitz des SS-Sturms erst in Penzberg, dann in Starnberg ist, spielt die "Schutzstaffel" in Wolfratshausen nie eine große Rolle. S. verlässt auch nicht, wie SS-Leuten vorgeschrieben ist, die katholische Kirche. Er bleibt sogar Mitglied des katholischen Gesellenvereins, selbst nachdem dieser in Wolfratshausen von der NSDAP verboten wird.
Als der Krieg ausbricht, wird S. Kurierfahrer für das Landratsamt. Später wird er als Reserve-Polizist dienstverpflichtet. Bis 1944 steigt er in dieser Funktion zum Bezirks-Oberwachtmeister auf - das ist gleichbedeutend mit dem Rang eines SS-Unterscharführers. Im katholischen Wolfratshausen bleibt S. weiter ein geachteter Mann.
Aus mehreren Gründen: Am 4. November 1933 wird Franziska K. verhaftet, weil sie "schwerbeleidigende Ausdrücke über die SA gebraucht hatte". S. paukt sie wieder frei.
Auch der Parteigenosse Mathias T. wird am 14. Mai 1936 in Schutzhaft genommen, "weil er Missstände, die örtliche Parteiführer herbeiführten und duldeten, mit offenen Worten bekämpfte". Nach vier Tagen erwirkt S. beim Gauamtsleiter in München dessen Freilassung.
"Heil Moskau" sagt Maria J. am 18. August 1936 zu einem SA-Truppführer. Sie wird umgehend verhaftet. S. fährt dreimal mit dem Ehemann von J. nach München in die Parteizentrale, endlich bekommt er auch Maria J. wieder frei.
Alle drei von S. dargestellten Hilfeleistungen werden von den Betroffenen im Entnazifizierungsverfahren 1947 bestätigt. S. wird als "großer Witzbold" gelobt, der "überhaupt nicht vom Nationalsozialismus überzeugt war" (Spruchkammer-Vorsitzender Hesselbarth). Er soll "im Gegenteil die neuesten Witze" über die Partei erzählt haben.
Käthe Jäger: "Ein Großteil der Bevölkerung, der nicht mit den Machenschaften der Partei einverstanden war,
hat gerade wegen seiner anständigen und korrekten Haltung, zu S. Sympathie und Vertrauen gehabt."
Und Karl Fuchs, später ein hochangesehener CSU-Stadtrat, schreibt über ihn: "Ich kann zusammenfassend erklären, daß S. meine Gesinnung jederzeit achtete und als Mann der Partei mir als Andersdenkendem immer loyal begegnete."
Heinrich Pflanz, ehemaliger Häftling in Lager Moosburg,
hat die Verhältnisse dort dokumentiert, auch in Zeichnungen.
10000 PGs in automatischem Arrest
So wie Anton S. schicken die Amerikaner 17 Würdenträger der NSDAP aus Wolfratshausen für Monate oder gar Jahre
in den "automatischen Arrest". Die US-Armee übernimmt vorhandene "Einrichtungen", wie etwa Camp No. 6 - so wird das Internierungslager Moosburg genannt. In dem Barackenlager, das von den Nazis für Kriegsgefangene eingerichtet worden war, befinden sich zwischen 1945 und 1948 etwa 10.000 ehemalige Parteigenossen in Haft.
Die Häftlinge leben dort unter unmenschlichen Bedingungen, viele verhungern. Die Angehörigen wissen meist nicht, wo sie sind. Die Tochter von Anton S.: "Wir haben von unserem Vater nur dann gehört, wenn irgend jemand einen Brief nach draußen geschmuggelt hat."
Ähnliche Lager wie Moosburg, wo die meisten Wolfratshauser Nazis hingeschafft werden, gibt es in der amerikanischen Zone einige Dutzend. Über sie ist auch heute noch recht wenig bekannt.
Berichte von ehemaligen Landsberger Häftlingen hat Heinrich Pflanz gesammelt. Seinem Buch "Das Internierungslager Moosburg" (1992, Selbstverlag) entstammen folgende Zeitzeugen-Berichte:
Georg Miller, Landwirt und unter den Nazis Bürgermeister eines kleinen Ortes: "In den ersten drei Tagen (im Lager) waren wir ohne jedes Essen. Viele sind verhungert. Einige aßen aus Hunger Papier und sind daran gestorben. Auch ein Kamerad aus unserer Baracke ist infolgedessen an Verstopfung gestorben. Ich sah ihn selbst in der Latrine liegen.
Als mir Frau B. am Zaun, der das Frauenlager vom Männerlager trennte, eine Suppe herüberreichen wollte, hat ein Posten auf mich geschossen. Da es in der Dämmerung war, konnte ich mich in eine Mulde retten. Monatelang mussten wir auf dem blanken Boden schlafen. Als Kopfunterlage hatte ich einen Ziegelstein, den ich mit Gras etwas auspolsterte. Das Gras wurde mir aber von der Lageraufsicht wieder weggenommen. Erst im Spätherbst 1945 bekamen wir Bretter, womit wir uns notdürftig eine Schlafstelle bauen konnten.
Bei meiner Verhaftung wie auch im Lager wurde ich wie die anderen Gefangenen unzählige Male geschlagen. (...) Im Herbst 1945 stand ich mit Stanislaus Schmid ca. 10 Meter vom Sicherheitszaun entfernt. Als sich Schmid nach einem Löwenzahn bückte, wurde er von einem Posten mit einem Schuss durch die Halsschlagader niedergeschossen.
Die Angehörigen waren lange ohne Benachrichtigung."
Angehörige nicht benachrichtigt
"Der Fischermeister Peter Ernst aus Dießen/Ammersee wird von den Amerikanern in seiner Wohnung verhaftet und ins Lager gebracht. Der Familie wird nur gesagt, dass Ernst verhaftet werde, weil er Ortsbauernführer war. Wohin er gebracht wird, erfahren sie nicht. (...)
Ernst kann nach einigen Monaten aus dem Internierungslager Moosburg einen in einem Leichenwagen versteckten Zettel herausschmuggeln, auf dem er mitteilt, wo er ist. Ernst ist ca. eineinhalb Jahre in Haft. Es ist nicht bekannt, dass ihm irgend etwas zur Last gelegt werden konnte."
Schauspieler Eichheim verhungert
Josef Eichheim, Jahrgang 1888, Münchner, ist in den 30er und 40er Jahren einer der beliebtesten deutschen Filmschaupieler. Zu den bekanntesten Streifen des Komödianten gehören "Der verkaufte Großvater" (1942), "Kohlhiesls Töchter" (1943) oder auch "Narren im Schnee" (1938).
Auch Eichheim war wohl Mitglied der NSDAP. Er kommt im Mai '45 in den "automatischen Arrest" nach Lager Moosburg.
Dort organisiert er ein Theater: "Kabale und Liebe" von Schiller wird aufgeführt. Im November 1945 verhungert Eichheim im Lager.
Auch Jost in Ludwigsburg
Der Zorn der Siegermächte auf die Nazis und die, die sie dafür halten, ist groß. Allein in der amerikanischen Zone sind Mitte Juli 1945 70.000 Menschen in Haft. In den Internierungslagern müssen sie in den ersten Monaten auf den Boden schlafen, später dann in drei Etagen übereinander - den "Kaninchenställen".
Sie bekommen wenig zu essen, Krankheiten gehen um, die Hygiene ist mangelhaft. Der rumänische Gesandte in Berlin,
General Gheorge, der in Ludwigsburg inhaftiert war, wie übrigens auch Wolfratshausens Bürgermeister Jost, schreibt:
"Am Tag gingen die meisten dieser Höhlenbewohner dem Lichte zu, das heißt, sie setzten sich am Rande der Lagerstätten auf und baumelten mit den Füßen über dem Kopf ihres Nachbarn von unten."
Die meisten Tbc-Fälle aus Moosburg
In einem Leserbrief an den Isar-Loisachboten schildert Eva Barthel aus Hohenschäftlarn im Mai 1995 ihre Erinnerungen:
"Am 1. Februar 1946 wurde ich im amerikanischen Kriegsgefangenen-Lazarett Hospital 2057 (Artillerie-Kaserne) Garmisch-Partenkirchen als Zivilangestellte (Röntgenassistentin) angestellt. Bei einer Patientenbelegschaft von 3000 bis 4000 waren zehn bis zwölf Prozent tuberkulös, zum Teil sehr schwer, es gab viele Tote. Die meisten Tbc-Fälle kamen aus Moosburg.
Dort gab es schlechte Ernährung, Kälte und schlimme Behandlung. Im Hospital taten die deutschen Ärzte, die ja selbst Gefangene waren, was sie konnten, um den armen Jungens zu helfen und wir Zivilen schrieben Briefe oder schmuggelten welche durch die Wache, dazu noch etwas freundlicher Zuspruch, mehr war nicht drin, da die notwendigen Medikamente fehlten. Das Herz tut mir jetzt noch weh, wenn ich daran denke, wie viele damals noch unnötig sterben mussten."
Der Rest der Geretteten
Prolog
"Die Juden sahen sich an.
Wo sind wir? Wohin sollen wir?
Für sie war alles unklar.
Nach Polen zurückkehren? Nach Ungarn?
In die von Juden verlassenen Straßen,
umherzuirren in diesen Ländern,
einsam ohne Heimat, immer die Tragödie vor Augen (...),
um dann einem ehemaligen freundlichen Nachbarn zu begegnen,
der dann mit großen Augen und einem Lächeln zweideutig fragen würde: ,Was, Du Jankel! Lebst Du auch noch?"
Ein Überlebender des Holocaust
Zuflucht im Föhrenwald
Hitlers Angriffskrieg hinterlässt 6,5 Millionen heimatlose Ausländer in Deutschland. Die Besatzungsmächte sprechen von DPs, von displaced persons. Die meisten sind verschleppte Zwangsarbeiter aus ehemals besetzten Gebieten. Bis Ende Juli 1945 sind zwei Drittel wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt.
Unter den DPs sind allerdings auch etwa 50.000 Juden, die den Holocaust überlebt haben. Wohin mit ihnen? Ihre Heimat ist Deutschland, ihre Heimat gibt es nicht mehr. Für sie werden eigene Lager geschaffen: Eines der größten und vor allem das, das am längsten besteht (bis 1955), ist das Lager Föhrenwald.
In den ehemaligen Häusern der Zwangsarbeiter der Munitionsfabrik in Gartenberg werden bis zu 6000 Juden einquartiert. Die meisten von ihnen wollen Deutschland verlassen - in Richtung USA, Kanada, auch Australien, aber vor allem in Richtung Israel. Die Überlebenden der Judenvernichtung nennen sich Scherit-Hapleita, der "Rest der Geretteten".
Die Begriffe Juden oder Displaced Persons (DP) wurden von den deutschen Behörden vermieden.
Die Einrichtung des DP-Lagers wird von der 3. US-Armee organisiert. Ihr Hauptquartier ist die Flint-Kaserne in Bad Tölz, die vormalige SS-Junkerschule (gebaut 1938, jetzt Landratsamt, d. Autor 2007). Die Soldaten sind mit ihrer Aufgabe überfordert. Major Irving Heymont: "Die US Army war nach Europa gekommen, um die Nazis zu bekämpfen und nicht, um deren Opfer zu bewachen."
Lager Föhrenwald wird militärisch streng geführt, selbst der in den Wirren zu Kriegsende teilweise zerstörte 2,5 Meter hohe Stacheldrahtzaun wird repariert - Föhrenwald ein Konzentrationslager? Earl Harrison, von US-Präsident Truman auf Inspektionsreise geschickt, besucht das Lager.
Sein Bericht wird in Washington mit Entsetzen aufgenommen: "Es scheint, als behandeln wir die Juden wie zuvor die Nazis, mit dem Unterschied, dass wir sie nicht vernichten." Truman reagiert sofort, die Juden bekommen einen Sonderstatus. Ohne weitere Prüfung werden sie als DP anerkannt, das Lagerleben wird völlig neu und nun auch demokratisch organisiert.
Lager Föhrenwald aus der Luft.
Durch die UNRRA geht's aufwärts
Im Herbst 1945 übernimmt die UN-Flüchtlingsorganisation UNRRA (später IRO) das Lager. Auch die größte amerikanisch-jüdische Hilfsorganisation "Joint" nimmt in Föhrenwald die Arbeit auf - erfolgreich: Sechs Wochen später gibt es Schulen und Ausbildungsstätten, ein Lager-Krankenhaus.
In Föhrenwald leben 600 Kinder und Jugendliche ohne Eltern. Die Zusammensetzung der Lagerbewohner ändert sich ganz entscheidend im Sommer 1946: In Polen finden Juden-Progrome statt und erneut flüchten Juden aus Angst vor Vernichtung aus ihrer Heimat. Etliche von ihnen kommen nach Föhrenwald.
Das Lager ist exterritorial, es untersteht den Vereinten Nationen und nicht deutschen Behörden. Auch die deutsche Polizei darf Föhrenwald nicht betreten. Das schafft Probleme. Lebensmittel-Diebstahl ist an der Tagesordnung: Wenn Bauern Vieh von der Weide gestohlen wird, führen die Spuren immer wieder nach Föhrenwald.
Allerdings ist die Versorgung der Lagerbewohner mit Lebensmitteln gut. Ihnen stehen täglich 2500 Kalorien zu, die Wolfratshauser haben nur Anspruch auf die Hälfte. In einer großen Lagerküche wird zentral gekocht. Die Bewohner des Lagers erhalten, so sie im KZ gewesen waren, auch finanzielle Wiedergutmachung.
Trotzdem ist das Leben in Föhrenwald sehr schwierig. Oft müssen mehrere Familien in einem Raum leben. Es gibt nicht genügend Möbel, in den Häusern wimmelt es von Ungeziefer. "Kaum war der Kammerjäger weg, waren die Wanzen wieder da", berichtet eine ehemalige Bewohnerin.
In schlechtem baulichen Zustand war Lager Föhrenwald.
Paramilitärische Ausbildung
Stark ausgeprägt ist das politische Leben in Föhrenwald. Eine ganze Reihe von Parteien - meist sind sie zionistisch, fordern also einen unabhängigen israelischen Staat - schickt Kandidaten in den Wahlkampf zum Lagerkomitee.
Auch die Haganah, eine Organisation, die in Palästina gegen die britische Kolonialmacht für die Befreiung des Landes kämpft, unterhält in Föhrenwald eine kleine Abteilung. Im ehemaligen Hochlandlager der Hitlerjugend bei Königsdorf führt die Haganah ein geheimes paramilitärisches Ausbildungsprogramm durch.
Selbst ein eigenes Lagergericht existiert in Föhrenwald. Als ein Lagerbewohner bei einem Fußballspiel einen Mitspieler beleidigt und schlägt, wird er zu drei Tagen Gefängnis verurteilt. In Wolfratshausen erfährt man von solchen Aktivitäten indes gar nichts.
Auch wenn das Verhältnis der Wolfratshauser zu den Bewohnern des DP-Lagers "ein eher herzliches ist"
(die ehemalige Bewohnerin Margreth Weisenfisz-Rudel), die Behörden des Landkreises Wolfratshausen haben viel Ärger mit dem Lager, das erst ab 1951 der deutschen Polizeigewalt untersteht.
So schreibt Landrat Thiemo am 25. November 1945 an den Regierungspräsidenten, dass der Landkreis "schwer leidet"
durch die Föhrenwalder, "die mit den von der UNRRA überreich erhaltenen Waren Tauschhandel aller Art betreiben".
Von Neid geprägt ist auch das (nach wie man heute weiß falsche) Gerücht, dass der Geldbesitz der Lagerbewohner "bei dem Einzelnen in die Zehntausende (geht), von manchen wird sogar behauptet, dass ihr Barbestand 50.000 RM überschreite".
Im DP-Lager Föhrenwald ab es natürlich auch einen Kindergarten.
Gesetzlose Zone
Und am 22. Januar 1946 schreibt Thiemo: "Nur die DP-Juden im Lager Föhrenwald übertreten die deutschen Gesetze nach Herzenslust. Aber wir sind dagegen machtlos, und die Razzien der Amerikaner bedeuten nicht viel."
Am 28. Mai 1952, als das Lager schon unter deutscher Verwaltung steht, soll eine Großrazzia mit 115 Zoll- und Steuerfahndern und 33 Polizisten stattfinden. Die geballte Ordnungsmacht trifft allerdings auf Widerstand bei den Lagerbewohnern, die sich an die Nazizeit erinnert fühlen - nicht ganz zu Unrecht übrigens.
Steine fliegen, die Polizisten schreien antisemtische Sätze wie "Die Gaskammern warten auf Euch". Aber bevor es zum offenen Konflikt kommt, wird die Aktion abgebrochen. Der Vorfall löst allerdings auf beiden Seiten anhaltende Verbitterung aus.
Die Falschgeld-Bande
Fast wie eine Legende klingt eine Geschichte vom Lager Föhrenwald, die heute noch in Wolfratshausen erzählt wird, für die es aber in den Archiven keine schriftlichen Belege gibt. So sollen im Lager auch ehemalige KZ-Häftlinge aus Dachau gelebt haben, die während des Krieges falsche Pfund-Banknoten zu drucken hatten. Adolf Hitler hatte diese über England abwerfen lassen wollen, um die Währung aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Nach der Befreiung nahm ein kleiner Kreis Dachauer Häftlinge die Druckmaschinen nach Föhrenwald mit und produzierte damit in einem Koffer deutsches Falschgeld. Der Betrug fiel erst auf, als sie auf dem Weg zum Münchner Oktoberfest mit ihrem Auto am Dorfener Berg einen Unfall hatten. Dabei sprangen die Koffer mit den nachgedruckten Reichsmark auf und das Geld fiel raus.
Der Traum vom Gelobten Land
18 Jahre jung ist Margreth Weisenfisz-Rudel, als sie 1948 mit ihrem Ehemann, dem in Polen aufgewachsenen Konfektionsschneider Chaim Weisenfisz (28), ins Lager Föhrenwald kommt. Margreth hat einen Traum: Sie möchte ins "Gelobte Land", nach Palästina, auswandern.
"Die Zustände im Lager waren unbeschreiblich", erinnert sich die heute 65jährige Jüdin. "Die Häuser waren alle völlig verwanzt. Wir mussten uns ein Zimmer mit einer Familie teilen. Dazu spannten wir eine Schnur durch den Raum, an die wir Decken hängten."
Ein Bad gab es auch nicht, lediglich Gemeinschaftsduschen in einem Haus am Lager-Eingang. Und trotzdem hat sie gute Erinnerungen an die acht Jahre Föhrenwald: "Wir waren jung und wir waren frei. Das war ein enorm schönes Gefühl."
Der Ortsplan von Lager Föhrenwald: Die Straßen tragen amerikanische Bezeichnungen.
Guter Draht nach Wolfratshausen
Beide nehmen eine Arbeit an, sie als Köchin in einem Koscher-Restaurant, er als Schneider. "Wohnen und Strom waren umsonst, von dem bisschen Geld, das wir verdienten, konnten wir uns dann nach und nach auch Möbel kaufen."
1950 kommt Tochter Esther zur Welt, im Lager-Krankenhaus. Die zweite Tochter Sonja wird dann schon
in der Kreisklinik Wolfratshausen geboren.
Apropos Wolfratshausen, Margreth Weisenfisz geht gerne in den Ort, besucht dort Sportveranstaltungen ("Box-Kämpfe habe ich geliebt") oder geht bummeln. "Die Leute in Wolfratshausen waren sehr nett, sehr freundlich und zuvorkommend. Da gab es keine Diskriminierung." Nur Freundinnen hat sie nie dort gefunden. "Im Lager lebten wir doch sehr isoliert."
Ausgewandert ist die Familie Weisenfisz übrigens nie. 1956 zog sie nach München, dort lebt Margreth Weisenfisz nun als Witwe. Eine Tochter ging indes in Haifa/Israel.
Wiedersehen im Lager
Schwester Ruth arbeitet im Krankenhaus des Lagers Föhrenwald. Ihre Geschichte ist auch heute noch, 50 Jahre danach, anrührend: Während des Kriegs wurde die im polnischen Ghetto in Lodz lebende Jüdin in einen Zug gesteckt, ein Zug ins KZ.
Irgendwo in Polen warf sie ihr Kind aus dem Zug - sie wusste ja, der Zug sollte in den Tod führen. Das elfjährige Kind überlebte den Aufprall und wurde von einem Partisanen mit halberfrorenen Beinen gefunden und aufgenommen.
Erst kurz vor Kriegsende wurden der Partisan und das Kind gefangen und in ein KZ verschleppt. Die Befreier kamen,
bevor beide in die Gaskammer geschickt wurden.
Auch Ruth überlebte das KZ. Vom Schicksal ihres Kindes wusste sie nichts, als sie nach Föhrenwald kam - bis eines Tages ein Fremder an die Tür ihres Nachbarn klopft - und erzählt: Nein, er habe keine eigenen Kinder, er habe ein fremdes Kind aufgenommen. Als Ruth das Foto anschaut, erkennt sie ihr Kind.
Ja, auch solche Geschichten passieren im DP-Lager Föhrenwald, in dem bis zu 6000 Juden leben - in der Hoffnung auf ein neues Leben in Israel. Der "Rest der Geretteten" macht Föhrenwald zu einer Enklave der untergegangenen europäisch-jüdischen Kultur.
Der "Rest der Geretteten" machte aus Föhrenwald eine Enklave europäisch-jüdischen Lebens.
Die Hochschule des Rabbi Halberstam
Die jiddische Sprache wird dort gepflegt, in den Schulen lernen die Kinder und Jugendlichen - Schulpflicht besteht bis 18 Jahre - Hebräisch, Englisch, Rechnen, Bibelkunde, Zeichnen, Musik und Sport. Bereits Anfang November 1945 werden von 27 Lehrern 350 Kinder unterrichtet.
Regen Zulaufs erfreut sich auch eine "Bet-Jakow"-Schule für die religiöse Erziehung der Mädchen. Für größere Kinder werden "Tarbut"-Gymnasialkurse eingerichtet.
Selbst eine religiöse Hochschule ("Talmud-Hochschule") gibt es im Lager Föhrenwald. Den Unterricht leitet Rabbi Yeshuskiel Yehuda Halberstam, der einzige bedeutende chassidische Lehrer (eine konservative Glaubensrichtung), der den Holocaust überlebt hat. Sechs Synagogen gibt es in Föhrenwald, die wichtigste ist in der heutigen Pfarrkirche untergebracht.
Jeden Sonntag ist Markt, weil am Samstag, dem Sabbat, nicht gearbeitet werden darf. Der Markt, der vor den Toren des Lagers stattfindet, ist bei den Wolfratshausern äußerst beliebt.
Eine Vielzahl von Geschäften entsteht im Lager: Lebensmittel- und Tante-Emma-Läden, Friseure, eine Schreinerwerkstatt. Hühner werden in Wolfratshausen und Umgebung donnerstags gekauft und von den Rabbinern koscher geschlachtet:
Vor dem Zerlegen müssen die Tiere ausbluten.
Auch kulturell ist einiges geboten. Es gibt mehrere Theatergruppen, es gibt eine Bibliothek, ein Kino, einen Sportclub,
und es erscheint eine Lagerzeitung.
Ausbildung für die Freiheit
So idyllisch wie es klingen mag, ist das Lagerleben indes nicht. Zwar werden schon ab November 1945 Ausbildungsstätten errichtet, für Krankenschwestern, Schneider, Schlosser, Schuhmacher, Zimmerer und anderes mehr - es fällt den Verantwortlichen des Lagers aber schwer, die Bewohner zum Arbeiten zu motivieren.
Manche sind nach den erlittenen Qualen dauerhaft zu schwach, andere wiederum empfinden es nach dem KZ als unzumutbar, für Deutsche tätig zu sein. Außerdem sind die Lebensmittelrationen im Lager höher als außerhalb, was den Zwang, Geld zu verdienen, für viele Juden gering erscheinen lässt.
Eigentlich soll das Lager am 18. Juli 1949 geschlossen werden. Aber es stellt sich bald heraus, dass nicht alle Juden in der Lage sind, nach Israel oder USA auszuwandern - Föhrenwald entwickelt sich zum Sammellager für die bis dahin 64 jüdischen Lager in Deutschland.
Am 1. Dezember 1951 geht das Lager in deutsche Verwaltung über. Die Schwierigkeiten sind groß. Nicht nur dass in Föhrenwald vorwiegend Alte, Kranke und Schwache leben, immer häufiger kehren enttäuschte Auswanderer aus Israel wieder dorthin zurück - zwar illegal, aber geduldet.
Mit 31 zu alt, um zu lernen?
Zum Beispiel Yossel, 31 Jahre alt: Seit er 21 ist, hat er in Lagern gelebt, erst im KZ, dann im DP-Lager und in Israel
in einem britischen Internierungslager. Nach der Unabhängigkeit des Landes "versuchte (ich), das zu werden,
was ich immer sein wollte, ein normaler Mensch. Aber nun war ich 33 Jahre alt. Zu alt, um etwas zu lernen,
und zu jung, um mich zur Ruhe zu setzen."
Den Behörden und den im Lager tätigen Hilfsorganisationen wird bald klar, dass nicht alle Föhrenwalder auswandern können. Also werden den dort lebenden Juden Wohnungen in deutschen Großstädten finanziert. Aber nicht alle nehmen dieses Geschenk widerspruchslos an: Zu groß ist die Angst vor dem Getrennt werden, von der Übernahme von Verantwortung in dem für sie fremden und noch immer Misstrauen erzeugenden Land.
Trotzdem finden 789 ehemalige Lagerbewohner in Deutschland eine neue Heimat. Die letzten Juden verlassen am 28. Februar 1957 das Lager - zwölf Jahre nach dessen Errichtung, nach einer Zeit, die fast ebenso lang war wie das Dritte Reich gedauert hatte.
Zu diesem Zeitpunkt sind schon deutsche Siedler in die Häuser eingezogen. Sie arbeiten dort für den Neuanfang - und es soll ein totaler Neuanfang sein: Am 7. November 1957 wird Föhrenwald nach einer Bürgerbefragung und langen Verhandlungen umbenannt: Fortan ist es der Wolfratshauser Stadtteil Waldram.
Die Isartal-Bahn hieß im Volksmund "Jerusalem-Express". Heute verkehrt auf der Trasse die S-Bahn Linie 7.
Der "Jerusalem-Express"
In miserablem Zustand sind nach dem Kriegsende die Straßen im Landkreis Wolfratshausen. Vor allem die Panzer der Amerikaner haben aus wichtigen Verbindungsstraßen Buckelpisten gemacht. Sie können erst nach dem Abzug der US-Truppen im Sommer 1945 nach und nach instand gesetzt werden.
Autos beschlagnahmt die Militärregierung. Nur auf Antrag und mit Begründung können die Wolfratshauser auf die Fahrbereitschaft zurückgreifen, die über Holzvergaser verfügt, über Autos also, deren Motor mit sogenanntem "Tankholz" angetrieben wird.
Auch die Isartal-Bahn verkehrt einige Monate überhaupt nicht und dann nur sporadisch. Ein Wolfratshauser erinnert sich an seine erste Fahrt mit der Dampfeisenbahn am 15. August 1945: "Die Fahrt dauerte sechs Stunden von München nach Wolfratshausen. Oft musste der Zug anhalten zum Nachschüren, denn anstatt Kohle gab's nur Kohlenstaub zum Heizen."
Erst ab 12. Oktober existiert dann "auf wiederholte und dringliche Forderungen des Landrats" bei der Reichsbahndirektion wieder ein Fahrplan. Um 6 Uhr und um 16.10 Uhr fährt von Wolfratshausen ein Zug ab und um 8 Uhr, und um 18.10 Uhr geht ab Isartal-Bahnhof Thalkirchen der Zug zurück.
Weitere Züge verkehren jeden Samstag um 11.32 Uhr (ab Wolfratshausen) und um 13.25 Uhr (ab München). Zum 1. Dezember 1945 wird die Zahl der Züge verdoppelt, die Fahrzeit beträgt eineinviertel Stunden. Das größte Problem ist, dass es kaum noch funktionierende Lokomotiven gibt: Sie müssen an Industriebetriebe abgegeben werden. Außerdem werden sie in München in der Ludwigs- und in der Nymphenburger Straße als Hilfs-Straßenbahnen eingesetzt.
Ab 1946 fahren die ersten elektrischen Triebwagen auf der Isartal-Linie. Sie kommen von der Wehrmachts-Bahn Peenemünde-Zinnowitz. Zu den häufigsten Benutzern gehören die im Lager Föhrenwald lebenden jüdischen DPs. Daher wird die Bahn im Wolfratshauser Volksmund auch "Jerusalem-Express" genannt.
Die Vertriebenen
Es wimmelt von Fremden
Im Landkreis wimmelt es von Fremden. Schon zu Kriegszeiten sind es die 4000 vorwiegend ausländischen Fremdarbeiter
der Munitionsfabriken in Geretsried, die aufgrund ihres anderen Aussehens und ihrer anderen Sitten für Aufsehen in Wolfratshausen sorgen.
Nach Kriegsende dann ändert sich die Struktur des vormals bäuerlichen Landkreises völlig - aufgrund der Vereinbarungen der Siegermächte in der Konferenz von Jalta (4. bis 12. Februar 1945) und im Potsdamer Abkommen (2. August 1945).
Die Bewohner der ehemals deutschen Gebiete im Sudetenland, in Schlesien und in Ostpreußen werden vertrieben.
In der Regel dürfen sie nur das mitnehmen, was in einen Koffer passt. Zwei Millionen von ihnen kommen allein nach Bayern.
An der Spitze in Oberbayern
Bis 1960 siedeln sich 13.564 Vertriebene im Landkreis Wolfratshausen an - bei einer ursprünglichen Bevölkerung von gerade 25.000 Menschen. Mit einem Flüchtlingsanteil von einem Drittel der Bevölkerung steht Wolfratshausen an der Spitze in Oberbayern.
Das Gesicht des Landkreises ändert sich dadurch ganz entscheidend. Beispiel Dorfen: Bei 195 Einheimischen werden im Oktober 1946 exakt 211 Evakuierte und Flüchtlinge einquartiert. Die Dorfener sind in Dorfen eine Minderheit.
Besonders groß sind die Probleme aber unmittelbar nach dem Krieg. Laut einem Bericht von Landrat Hans Thiemo leben
bereits am 29. August 1945, als die Not am größten ist, 2800 Heimatvertriebene im Landkreis. Dazu kommen fast 10.000 Evakuierte, vorwiegend Menschen, die aus ihren ausgebombten Häusern in den Großstädten aufs Land gezogen sind.
Selbst aus München müssen 100.000 Leute evakuiert werden, weil "die meisten Wohnungen überbelegt und größtenteils beschädigt (sind). Sie können vor Einbruch der kalten Jahreszeit mangels Baumaterialien nicht repariert, die Fenster nicht verglast werden".
Die meisten Menschen werden aber ab Herbst 1945 wieder in ihre Heimat "planmäßig zurückgeführt" (Thiemo). Mitnehmen dürfen sie nichts: "Kein Bürgermeister darf einen Evakuierten einen Herd oder Eisenofen mitnehmen lassen, wenn dieser zurückwandert, auch nicht gegen höchste Bezahlung." Am 25. Januar 1946 halten sich nur noch knapp 5000 Evakuierte im Landkreis auf.
Aus ihren jahrhundertealten Siedlungsgebieten in Böhmen
und Mähren wurden ab 1945 die Deutschstämmigen vertrieben.
Alle müssen zusammenrücken
Aber die Flüchtlinge aus dem Osten brauchen Wohnungen - das größte Problem. Im Herbst 1945 schreibt Landrat Thiemo an die Bürgermeister: "Dabei muss angesichts der ungewöhnlichen uns erwartenden Winternot jeder Familie zugemutet werden, in einem einzigen Raum zu wohnen, nach Möglichkeit sogar in der Küche." Als Thiemo dies schreibt, leben bereits 4200 Heimatvertriebene im Landkreis. Ende 1946 sind es schon mehr als doppelt so viele.
Für die Organisation der Flüchtlingstransporte wird eine eigene Behörde gegründet. Jedem Landratsamt wird
ein Flüchtlingskommissar zugeordnet, in Wolfratshausen ist dies Hanns Severing, sein Büro ist im dritten Stock des Landratsamts.
Severings Aufgabe ist "die Betreuung der Flüchtlinge von ihrem Eintreffen im Kreis bis zu ihrer endgültigen Unterbringung in Wohnung und Arbeit". Dafür erhält der Flüchtlingskommissar, später ist es ein Herr Kraft, "das Recht zur Beschlagnahme von Wohnräumen aller Art".
Es wird eng in Wolfratshausen: "Alle Flüchtlingsfamilien haben vorläufig nur Anspruch auf Unterkunft. Familien mit Kindern unter 14 Jahren sind möglichst in heizbaren Räumen unterzubringen. Einzelstehende Männer müssen mindestens zu je zwei Personen ein Zimmer beziehen, ebenso Frauen."
Der Tölzer Landrat Anton Wiedemann: "Die Maßnahme verlangte von den Ortsansässigen große Opfer und Einschränkungen. (...) Es muss zu Ehren der Bevölkerung gesagt werden, dass sich die Durchführung der Maßnahmen
ohne große Reibereien abwickeln ließ."
Ab Mai 1946 haben die Flüchtlinge auch rechtlich einen Sonderstatus. Sie bekommen eigene Ausweise, versehen mit einem Fingerabdruck. Sie werden in einer Kartei registriert und erhalten gegen Vorlage ihres Flüchtlingsausweises Lebensmittel- und sonstige Bezugsscheine.
Die Neuankömmlinge aus dem Sudetenland mussten unter erbarmungswürdigen
Umständen im Barackenlager auf der Böhmwiese neu anfangen.
Plünderer zerstören die Fabriken
In den Tagen und Wochen nach dem Kriegsende toben in den geschlossenen Munitionsfabriken der Dynamit AG (Gartenberg) und der Deutschen Sprengchemie (Geretsried) die Plünderer. Noch bevor die amerikanischen Besatzer die Ordnung wieder herstellen, rauben die bisherigen Zwangsarbeiter alles, was nicht niet- und nagelfest ist.
Installationen, Glas, Türen und Heizkörper werden zerschlagen, und es bleiben "fast überall nur die nackten Mauern,
deren Beton dem Zugriff trotzt", berichtet Dr. Friedhelm Funke - und es bleibt der 2,50 Meter hohe Zaun um das Gelände.
Der sorgt ab Herbst 1945 dafür, daß die Demontage und Zerstörung der ehemaligen Rüstungswerke ordnungsgemäß ablaufen kann. Wie schon zu Kriegszeiten ist das Betreten des Geländes streng verboten.
Der Loisach-Isar-Bote veröffentlicht folgende "Warnung" der Werksleitung: "Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Betreten des Geländes der Fabrik Wolfratshausen (DAG und DSC) nur solchen Personen gestattet ist, die mit Sonderausweisen und besonderen Kennzeichen ausgestattet sind. Wer von den Wachen im Fabrikgelände angetroffen wird (...), läuft Gefahr, erschossen zu werden."
Alliierte nehmen Maschinen mit
Die Militärregierung setzt deutsche Treuhänder ein, die die Demontage zu überwachen haben. Schon ab 1945 wird die DSC im Süden abgebrochen: Wichtige Bunker werden gesprengt, der größte Teil der Maschinen und des Inventars wird von den Alliierten beschlagnahmt.
Allein für den Abtransport der Nitropenta-Anlage nach England sind nach Erinnerung einer Zeitzeugin 40 Lastzüge notwendig. 500 Arbeiter der Firma Joseph Best, München, führen die Demontage durch, während sich schon die ersten Industriebetriebe des neuen Geretsrieds ansiedeln. In Gartenberg beginnt die Demontage erst Ende 1947. 122 von 391 Bunkern werden auf Anordnung der Amerikaner gesprengt, sämtliche funktionsfähigen Maschinen abtransportiert.
Der Wert der in ganz Geretsried verbleibenden Anlagen wird auf 20 Millionen Mark geschätzt. Ab August 1947 steht das Gelände unter deutscher Verwaltung.
Geretsried: 30 Menschen pro Waggon
"Am 5. April 1946 wurden wir, fein säuberlich sortiert zu je 30 Personen pro Viehwaggon, verladen. 40 Wagen à 30 Menschen ergaben ca. 1200 Personen. Beim Einladen hielt man zum Glück die richtige Reihenfolge ein: Zuunterst die Kisten, darauf die Menschen, und wir Kinder fanden, da meist unterernährt und schmalbrüstig, in kleinen Stauräumen unter dem Waggondach Platz.
Nachdem man uns noch mit etwas Reiseproviant versorgt hatte, wurden die Wagen verschlossen, und ab ging die Post respektive Bahn Richtung Westen. Über Eger, auf dessen Bahnhof nach meiner Erinnerung Hunderte zerstörter Lokomotiven standen, verließ der 3. Graslitzer Transport die Tschecheslowakei.
Am Samstag abend trafen wir in München-Allach ein, wo die Wagenkolonne in zwei Teile zu je 20 Wagen aufgeteilt wurde. Die erste Hälfte fuhr am Sonntag morgen weiter in Richtung Wolfratshausen und landete schließlich am frühen Vormittag vor dem Lager Buchberg (...).
So standen wir nun auf freier Strecke und sahen entsetzt auf ein völlig verkommenes, von doppeltem Stacheldraht umgebenes und mit Wachttürmen bewehrtes Barackenlager, das unsere neue Heimat sein sollte."
Werner Sebb, Geretsried
Eng und primitiv ist das Lager Buchberg. Aber die Vertriebenen sind froh, ein neues Zuhause zu haben.
Keimzelle Lager BuchbergDie Geschichte der Vertriebenen im Landkreis Wolfratshausen ist die Geschichte der Stadt Geretsried. Weil 1946 sämtliche in Betracht kommenden Unterkünfte im Landkreis mit Flüchtlingen belegt sind, öffnen die Behörden das leerstehende Lager Buchberg auf der (heute so genannten) Böhmwiese. Im Krieg lebten dort vorwiegend russische Fremdarbeiter der Munitionsfabriken, später 300 deutsche Kriegsgefangene.
Lager Buchberg, die Keimzelle Geretsrieds, der heute größten Stadt im Landkreis, umfaßt gerade einmal 20 hölzerne Baracken. Der erste Flüchtlingstransport aus dem egerländischen Graslitz zählt 556 Menschen, darunter auch Werner Sebb.
Ein Vierteljahr später kommt ein weiterer Flüchtlings-Zug mit 137 Menschen aus dem westböhmischen Tachau, und am 11. Oktober 1946 folgen 100 ehemalige Karlsbader. Auch Vertriebene aus Schlesien werden nach Geretsried eingewiesen.
Keine Türen, keine Betten, kein Strom
Der Zustand des Lager Buchbergs im April 1946 ist erbärmlich. Die Türen und Fenster sind zerstört, die Stromkabel hängen herunter, Öfen und Möbel sind weg. Werner Sebb: "Soweit Bettgestelle vorhanden waren, fehlten Matratzen und Strohsäcke, und Wasseranschlüsse sowie Toiletten waren ohnehin nie vorhanden gewesen. (...)
In der ehemaligen Lagerküche (später Gaststätte Böhm) standen große Kochkessel, zum Teil enthielten sie noch verschimmelte Reste von Möhreneintopf. Vom früheren Kantinenbau, seitlich an die Küche angebaut, waren nur noch verkohlte Balken auf einem riesigen Betonfundament übrig."
Die Neubürger packen an: Eine Lagerwerkstatt wird eröffnet. Ein Klempner und ein Elektriker arbeiten dort.
Eine Verkaufsstelle für Milch und Brot wird eingerichtet. Aber es dauert einige Zeit, bis sich die ehemaligen Graslitzer
selbst versorgen können. Bis dahin wird gemeinschaftlich gekocht.
Nur geringfügig leichter ist der Neuanfang der früheren Tachauer. Sie sind im ehemaligen DAG-Verwaltungsgebäude einquartiert, dem heutigen Rathaus. Der Rauchabzug der schwer zu beschaffenden Öfen wird einfach aus den Fenster hinausgeleitet.
Besonders schwierig ist es, die Flüchtlinge aus Karlsbad unterzubringen - denn das Lager ist im Oktober 1946 schon voll.
Die meisten von ihnen leben für Wochen in einem 150 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum und schlafen auf dem blanken Zementfußböden, da erst viel später Holzgestelle für Strohsäcke und Matratzen bereitgestellt werden.
Das Leben normalisiert sich
Aber das Leben normalisiert sich immer mehr. Geschäfte werden eröffnet, die Menschen finden Arbeit, zum Teil bei der Demontage der Rüstungswerke, manche in der Tölzer Flintkaserne, wieder andere im DP-Lager Föhrenwald. Und nicht zuletzt werden auch die ersten Industriebetriebe eröffnet.
Schon am 8. Mai 1946 hatte Ernst Schumann die Erlaubnis bekommen, im Geretsrieder Süden die Chemische Fabrik Rudolf & Co. wiederzugründen. Weitere Unternehmen folgen, Golde, Filler & Fiebig und Empe.
Auch der Wohnungsbau beginnt: Zu den ersten Anlagen die entstehen, gehören die Häuser an der Kolbenheyerstraße.
Am 24. Juni 1950 wird die Gründung der Gemeinde Geretsried festlich begangen.
Ein neues Kapitel beginnt.
Etwas Neues: Demokratie
Winibald muss wieder ran
Wie erzieht man ein Volk nach zwölfjähriger Diktatur zur Demokratie? Eine schwierige Aufgabe auch für die amerikanische Militärregierung in Wolfratshausen: Sie überlässt den Übergang zu demokratischen Verhältnissen weitgehend bewährten Kräften.
Schon einen Tag nach dem Einmarsch am 30. April 1945 wird Hans Winibald zum Bürgermeister ernannt. Er hatte dieses Amt bereits zwischen 1924 und 1933 - und behält es bis 1958.
Ihm zur Seite steht Franz Geiger, aufrechter Sozialdemokrat und ebenfalls anerkannter Nazi-Gegner. Auch die weiteren Mitglieder des provisorischen Gemeinderats sind nie in der Partei gewesen: Löwenbräu-Wirt Josef Schwaiger, Fuhrunternehmer Quirin Preiß, Lokführer Rudolf Assmann, Postschaffner Thomas Hartl, Landwirt Georg März und Kaufmann Anton Geiger.
Bald werden die Parteien gegründet. Aus einem Herren-Zirkel, der "Löwenbräu-Regierung", geht die CSU hervor -
die Nachfolgerin der Bayerischen Volkspartei der Weimarer Republik.
Und "Arbeiter, Bauern, Angestellte, Landwirte, Schaffende aller Stände" werden in Anzeigen aufgerufen, der SPD beizutreten. Den Kreisvorsitz führen Fritz Bauereis, der als Altgenosse 1933 von den Nazis verhaftet worden war, und Josef Kolbinger.
Gedrückte Stimmung, Unzufriedenheit
Sehr aufschlußreich über die Situation im Nachkriegs-Wolfratshausen sind die Stimmungsberichte, die der Wolfratshauser Landrat Hans Thiemo einmal im Monat an den Regierungspräsidenten in München schickte. Nachfolgend einige Auszüge:
12. September 1945: "Gedrückte Stimmung der Bevölkerung, wachsende Unzufriedenheit, völlige Verkennung der Lage bei der breiten Masse. Die erwarteten Wahlen werfen bereits ihre Schatten voraus, wobei vor allem die Tätigkeit der Kommunisten kampfeslustig und rege ist. (...)
Das in seiner Bequemlichkeit eingeengte Spießbürgertum äußert lebhafte Unzufriedenheit. Es ist eben unbelehrbar. Auffällig ist die große Arbeitsunlust, besonders der jüngeren Generation."
24. Oktober 1945: "Die Stimmung der Bevölkerung ist vom Nullpunkt nicht mehr weit entfernt. Sie ist enttäuscht und verbittert und von einem tiefen Pessimismus durchdrungen.
Eine feindselige Stimmung gegen die Amerikaner besteht nicht, denn die Vorgänge in der russischen Zone sind allzu bekannt und der Großteil der Bevölkerung weiss, dass sich unsere Lage unter der fremden Besatzung noch viel mehr verschlimmern könnte, ohne dass man daran etwas zu ändern in der Lage wäre, aber man ist über die Gleichgültigkeit der Amerikaner befremdet.
Diese sind eben andere Menschen wie wir und haben zuweilen oft den unsrigen vollständig entgegengesetzte Lebensgewohnheiten. Ungeheuer ist der Mangel an Waschmitteln, an Seife und an den kleinen Dingen des täglichen Gebrauchs, Schuhbänder und ähnliches."
"Stimmung gleicht tiefem Hinbrüten"
19. November 1945: "Die Stimmung in der Bevölkerung gleicht einem trüben Hinbrüten. Man weiß allgemein,
dass uns Schlimmes bevorsteht, hofft aber persönlich mit einigen Hautabschürfungen davonzukommen.
Höhere Gesichtspunkte spielen im Denken des Volkes keine Rolle.
Von Sympathien gegenüber den Amerikanern kann, von wenigen Schmarotzern abgesehen, nicht die Rede sein. Man ist (...) unzufrieden, weil man sieht, dass vieles viel besser laufen würde, wenn die Amerikaner weniger willkürlich vorgehen.
Gerade die Selbstherrlichkeit der Amerikaner und ihre Verachtung, die sie uns gegenüber immer deutlicher zur Schau tragen, verletzt den Teil der Bevölkerung, der für den Wiederaufbau des Staates in erster Linie in Frage käme.
In sittlicher Beziehung ist es in der letzten Zeit nicht schlechter, aber leider auch nicht besser geworden. Es ist nur ein kleiner und nicht sehr geachteter Kreis vorwiegend nicht bayerischer Elemente, der sich dem Sinnentaumel hemmungslos hingibt.
Die amerikanischen Soldaten wildern allnächtlich in den Wäldern mit Scheinwerfern und schießen ab, was ihnen vor die Flinte kommt.
Die Amerikaner sind misstrauischer denn je und Beeinflussungen von dritter Seite sehr zugänglich. Die Einstellung der
hiesigen Militärregierung ist ausgesprochen bayernfeindlich.
Man verübelt es der Bevölkerung, dass sie nicht mehr vom Krieg verspürt hat, als das tatsächlich der Fall war, mit anderen Worten, dass unsere Häuser noch stehen und unser Privatbesitz noch einigermaßen unangetastet geblieben ist.
Einseitige Parteinahme zugunsten der Evakuierten und Flüchtlinge, insbesondere der Preußen, ist feststellbar. Diese haben es verstanden, das bayerische Nazitum als den Quell allen Übels hinzustellen.
Der Dichter Ernst Wiechert und seine Familie spielen die erste Geige. Er ist der verwöhnte Liebling der Amerikaner.
Im Vergleich zu seinem Einfluss ist der des Landrats gleich null."
"Grauen vor Flüchtlingsstrom"
21. Dezember 1945: "Die Stimmung in der Bevölkerung ist nach wie vor ernst und gedrückt. Alle Welt lebt in Angst und Furcht vor der Zukunft. Die nazistischen und militaristischen Kreise benehmen sich zurückhaltend. Staatsfeindliche Regungen waren nirgends festzustellen."
22. Januar 1946: "Müde Stimmung in der Bevölkerung wegen der überschnellen und überstrengen Entnazifizierung, wegen der ausbleibenden Wirtschaftsbelebung, wegen des allgemein verbreiteten Denunziantentums und wegen der deutlich fühlbaren Ablehnung durch die Amerikaner.
Die Besitzenden, auch die allerkleinsten, die technischen und kaufmännischen Angestellten der Privatindustrie, die Kunstgewerbler und ein großer Teil der Künstlerschaft fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Dem erwarteten Flüchtlingsstrom wird mit allseitiger Besorgnis, um nicht zu sagen mit Grauen, entgegengesehen."
Bäuerliche, katholische Wähler
Die ersten Gemeinderatswahlen sind für den 27. Januar 1946 angesetzt. Landrat Hans Thiemo schreibt am 24. Oktober 1945 an die Bezirksregierung in München: "Die Bildung der Parteien hat sich im Stillen vollzogen und zwar steht der Großteil der Bevölkerung, wie bei dem bäuerlichen, katholischen Landkreis nicht anders zu erwarten, hinter der Christlich-Sozialen Union.
Nach dieser Partei dürfte die Sozialdemokratische Partei die meisten Stimmen (...) erhalten. Die Kommunistische Partei ist weitaus die regste, sie wird von aus München zu Besuch kommenden Funktionären geleitet, von denen anzunehmen ist, dass sie ihre Informationen unmittelbar aus Moskau beziehen."
Das Treiben der Radikalen beunruhigt Thiemo sehr. Am 19. November schreibt er nach München: "In Gemeinden mit armer, nicht in Landwirtschaft stehender Bevölkerung, zum Beispiel Höhenrain, Weidach, Baierbrunn sind eine Reihe kommunistischer Stimmen zu erwarten."
Der Landrat hat Unrecht: In keiner Gemeinde im Landkreis Wolfratshausen setzen sich kommunistische Kandidaten durch. Meist sind es partei-reie Bewerber, die in die Gemeinderäte einziehen.
In Wolfratshausen, wo die Wahlbeteiligung 83 Prozent beträgt, kommt die CSU auf fünf Sitze (Franz Finsterwalder, Georg März, Johann Reiser, Josef Bauer, Bartholomäus Graf), die SPD auf vier (Franz Geiger, Rudolf Ansmann, Thomas Hartl, Alois Schuster).
"Wir sind besser als unser Ruf"
Die moralische Verantwortung dieses ersten Gemeinderats ist groß. Aus einem Appell von Landrat Hans Thiemo vom 12. Juni 1945: "Es liegt im Interesse unser aller, vor den Amerikanern sauber dazustehen, denn von der Meinung, die sie sich von uns bilden, hängt vielleicht unser Wohl und Wehe ab.
Lassen wir uns durch nichts entmutigen! Zeigen wir, dass wir besser sind als unser Ruf! Verbergen wir unseren Schmerz und unsere Enttäuschung! Vergessen wir nicht die Ursache des gegen uns wütenden Hasses! Ein Sieger lässt nicht mit sich rechten.
Hoffen wir trotz allem auf den Gerechtigkeitssinn und die Großmut des weltgebietenden amerikanischen Volkes, das in kaum 170 Jahren einen unerhörten, einzig dastehenden Aufstieg genommen und auf seinem triumphalen Weg nie einen Rückschlag erfahren hat. Ein Volk wie dieses wird seinen Ruhm nicht beflecken. Habt Vertrauen!"
Gut ein halbes Jahr später, am 18. Februar 1946, wird der frühere Oberstudienrat Thiemo von den Amerikanern seines Amtes enthoben. Bei einer Bauernversammlung in Beuerberg hat er sich über die Lebensmittel-Lieferungen aus USA beschwert haben. Grundtenor: Der Mais sei Hühnerfutter. Ähnlich hatte sich auch der Bundes-Ernährungsminister geäußert, der danach ebenfalls gefeuert wurde.
Thiemo geht, Thieme kommt
Zwei Monate lang führt der Landratsamts-Jurist Anton Furch die Geschäfte des Landkreises, bevor das Bayerische Innenministerium Willy Thieme aus dem Ärmel zaubert. Der in Zürich geborene und in München aufgewachsene SPD-Politiker soll erstmal aufräumen. Thieme macht Karriere, als Landtags- und Bundestagsabgeordneter und von 1966 bis 78 als Wolfratshauser Bürgermeister.
"Ich weise die Herren Bürgermeister an, mit ihren Gemeinderäten zu prüfen, ob in ihrem Bereich Nationalsozialisten und Militaristen ansässig sind, die sich Naziverbrechen zuschulde kommen ließen. Zur besseren Erklärung, welche Kategorie von Personen gemeint ist, weise ich darauf hin, dass die bekannten Nazis Dr. P. (der Bezirksarzt, d. Autor), Dr. V. (der Notar, d. Autor) und Bürgermeister Jost als hier anzeigenswert erscheinen."
Thieme, ein strenger Katholik, schafft sich damit Feinde: Schon bei den ersten freien Landratswahlen am 25. April 1948
muss er seinem CSU-Kontrahenten Dr. Reichhold (Icking) Platz machen.
Die CSU hat aber auch bei den Kreistagswahlen am 28. April 1946 die Nase vorn: Sie erhält im ersten freigewählten Kreistag zwei Drittel der Stimmen (17 Sitze). Die SPD kommt auf sechs Mandate, die Wiederaufbauvereinigung auf eins.
Ende gut: 1950 bekam die Pfarrkirche St. Andreas neue Glocken. Die alten waren 1942 eingeschmolzen worden.
Nachworte
1933 - nie wieder!
Als die Nazis im Januar 1933 die Macht übernahmen, war ich sieben Jahre alt. Mit 21 Jahren wurde ich nach fast vier Jahren russischer Gefangenschaft mit schwerer Distrophie in die besetzte und zerstörte Heimat entlassen. Am 8. Februar 1945 hatten uns die Russen in Schlesien überrollt. Meine Kameraden, alles 17-jährige Schüler, waren tot.
Für mich brach damals die Welt zusammen. Ich hatte ja keine andere gekannt. Kaum jemand kann sich das heute noch vorstellen. Um so verdienstvoller ist die Herausgabe dieses Buches mit zeitgenössischen Berichten aus dieser schlimmen Zeit.
Wie aber konnte es letztlich so weit kommen? Die Machtergreifung der Nationalsozialisten war etwas Neues, Vielversprechendes. In allen Städten und Dörfern rumorte es. Es war eine Suggestion dabei zu sein, dazu zu gehören, nicht zu spät zu kommen. Die massenhaften Parteieintritte waren nicht nur opportunistisch. Man rechnete in der breiten Masse nicht damit, dass Parteien aufgelöst würden. Der Volksjubel wirkte ansteckend.
Die kaiser- und königslose Zeit schien vorbei zu sein. Man hatte einen, dem man zujubeln konnte. Es gab das Radio neuerdings, aus dem man in jedem Haus, in jeder Hütte die Stimme des Führers empfangen konnte. Es war neu und eindrucksvoll. Ob er in München sprach oder in Berlin, man konnte ihn hören.
Noch etwas kam dazu: Man glaubte, in der Welt wieder etwas darzustellen. Das Saarland war abgetrennt, die Ruhr besetzt, der Versailler Vertrag lastete schwer auf der Wirtschaft. Für alle sollte es Arbeit und Brot geben. Die ganze Misere der Zwanzigerjahre sollte vorbei sein, auch der Preisanstieg. Die Jugend kommt von der Straße, und Ordnung herrscht überall, so lauteten die Hoffnungen.
Auch hat man nie damit gerechnet, dass Hitler den Kirchen den Krieg erklären würde. Entfernt nicht dachte man an eine Kristallnacht oder an einen Judenstern. Und dann war da ja die große Vaterfigur der Nation, Hindenburg, der Hitler schließlich einführte, der Tag von Potsdam als Symbol der Versöhnung konservativer Kreise mit dem nationalsozialistischen Umsturz.
Hitler erscheint den Zeitgenossen als moralistischer Rigorist und Saubermann. Die Maske fällt aber mit dem Erreichen der Macht. Die Rüstung zum Krieg betrug sechs Jahre, und sechs Jahre währte dann der Krieg selbst. Schon früh, da und dort, kam das Erwachen - in breiter Front erst in den letzten Kriegsjahren, da wir ja durch die Luftangriffe den Krieg zu jedermanns Augen in der Heimat hatten. Die kompletteste Niederlage unserer Geschichte hat unser Land auf viele Jahre zerrissen - bis hin zu jenem glücklichen Datum der deutschen Wiedervereinigung am 9. November 1989.
Wohin weist heute unser Weg? Niemand soll glauben, dass die niederen Instinkte, mit denen der Nationalsozialismus gearbeitet hat, auf wundersame Weise aus den Menschen verschwunden wären. Ich denke an Neid, Sadismus, Hang zu Gewalttätigkeiten und den leicht zu entzündenden Hass auf Minderheiten. Ich erinnere nur an die zahlreichen Vorfälle im Zusammenhang mit Asylbewerbern, Brandanschläge, öffentliche Diskriminierungen, ja sogar Mord und Totschlag.
Dies alles zeigt uns, dass Vorsicht am Platz ist. Dass sehr schnell vergessen wird. Innere Sicherheit vor politischen Verführungen ist uns keinesfalls angeboren, auch nicht nach den schrecklichen Erfahrungen der NS-Zeit. Unsere Wachsamkeit ist deshalb besonders gefordert.
Von daher erfreut mich die Bereitschaft junger Menschen, für soziale Anliegen, Umweltschutz, Friedenssicherung oder andere aktuelle Themen einzutreten. Wir müssen miteinander diskutieren, aber auch bereit sein, den Mitmenschen zu respektieren und zu tolerieren. Denn Intoleranz und Fanatismus sind die größten Übel in unserer Welt. Das vorliegende Werk wird uns daran erinnern.
Bad Tölz, im November 1995
Dr. Otmar Huber,
Landrat
Vorurteilsfrei auseinandersetzen
Die in diesem Band gesammelten Berichte und Dokumente über die NS-Zeit im Altlandkreis Wolfratshausen, über das Ende der Diktatur vor 50 Jahren und den Neubeginn danach erschienen im April und im Mai als Artikelserie
im "Isar-Loisachboten". Ich habe die Berichte damals mit großem Interesse gelesen, behandeln sie doch eine Zeit, die ich als Kind in Wolfratshausen selbst erlebt habe. An viele Dinge konnte ich mich noch erinnern, wieder andere kannte ich aus den Erzählungen meines Vaters, aber etliches war mir nicht bekannt gewesen.
Es ist, denke ich, sehr wichtig, sich mit der damaligen Zeit auseinanderzusetzen - und zwar möglichst vorurteilsfrei. Wie leicht ist es, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und ihm seine Fehler vorzuwerfen. Fragen wir uns, wie wir uns selber verhalten hätten, wenn wir vor 50, 60 Jahren während des Nazi-Regime gelebt hätten.
Fragen wir uns doch einmal, in welcher Weise wir uns in das System eingefügt hätten. Zum Widerstandskämpfer sind damals wie heute nur wenige Menschen geboren. Also hüten wir uns, den Stab über unseren Eltern und Großeltern zu brechen.
Die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, geben Zeugnis auch vom Alltag in Wolfratshausen während des Dritten Reichs, ein Alltag, den wir uns in unserer Demokratie nicht mehr vorstellen können, ein Alltag mit Fahnengrüßen, der Allgegenwart von Uniformen, ein Alltag mit Blockwarten und der Angst vor Dachau. Ebenso wenig in unsere Zeit passen die Armut und die wirtschaftliche Not der Menschen während und nach dem Krieg. Aber lassen wir uns nicht täuschen: Diese Zeit ist gerade einmal 50 Jahre vorbei.
Die Distanz von 50 Jahren ist sicherlich hilfreich für ein solches Buch, mit dem auch Emotionen geweckt werden sollen. Die Familien, um die es hier geht, gibt es immer noch. Und noch immer wird die Vergangenheit gerne unter der Decke gehalten. Warum? Für die Sünden der Vorväter kann die heutige Generation nicht verantwortlich gemacht werden. Darum werden in diesem Buch auch die Namen der vielen, vielen Mitläufer und Nutznießer des Nazi-Regimes bewusst abgekürzt.
Gleichwohl können wir alle uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Soll niemand sagen, er habe nicht gewusst, was im Namen der Partei, im Namen der NSDAP und Adolf Hitlers alles an Unrecht geschieht. Es ist an jedem einzelnen, sich unabhängig von der damaligen Entnazifizierung mit seiner persönlichen Schuld auseinanderzusetzen.
50 Jahre nach dem "Todesmarsch" der Dachauer KZ-Häftlinge, 50 Jahre, nachdem Bomben auf Kirchen und Bauernhöfe im Landkreis Wolfratshausen fielen, 50 Jahre, nachdem die Menschen in die Wälder gingen, um Bucheckern zu sammeln.
Es ist Zeit, inne zu halten und sich bewusst zu machen, dass für die Freiheit und den Frieden, in dem wir heute leben, die uns unseren Wohlstand und unseren Individualismus ermöglichen, damals die Weichen gestellt wurden.
Das Ende ermöglichte den Neubeginn.
Wolfratshausen, im November 1995
Peter Finsterwalder, 1. Bürgermeister
Epilog I: Überlebt!
Karl Schusters "Erlebnis-Bericht"
Zu den wenigen Wolfratshausern, die es im Dritten Reich wagten, auch in aller Öffentlichkeit eine andere Meinung zu vertreten als die nationalsozialistischen Machthaber, gehörte der katholische Priester Karl Schuster. Er kam mit 28 Jahren im Dezember 1933 nach Wolfratshausen als Kooperator an die von Pfarrer Mathias Kern geleitete Pfarrei.
Fünf Jahre später wurde er wegen seiner systemkritischen Äußerungen nach München-Ramersdorf versetzt. Aber auch hier hielt Schuster nicht den Mund. Im August 1939 wurde er verhaftet und landete im Gefängnis. Die Erlebnisse aus sechs Jahren Haft und beim abschließenden "Elendsmarsch" hat der 1930 geweihte Priester im September 1946 in einem Bericht niedergeschrieben, der nachfolgend (leicht gekürzt) veröffentlicht wird.
Schuster starb im Dezember 1978.
"Jetzt kommt der Schwarze"
1933 kam ich nach Wolfratshausen als Hilfsgeistlicher. In dieser Pfarrei war seit 1922 der aufrechte und eifrige Pfarrer Mathias Kern tätig. Es war bezeichnend, dass kurz nach meiner Ankunft, einige Tage vor Weihnachten und am Todestag seiner Mutter, Pfarrer Kern ein Schreiben überbracht wurde, in dem ihn der nazistische Gemeinderat mit den Unterschriften aller Gemeinderäte "ablehnte".
In dem mich treffenden Bereich der Seelsorge, zu dem auch die Leitung der männlichen Jugend und ihrer Organisationen gehörte, mehrten sich von Jahr zu Jahr die Angriffe, erst versteckt, später offen. Sie richteten sich gegen alle Gebiete der Seelsorge, in Schule und Predigt, besonders gegen jede katholische Jugendarbeit. und sie machten nicht einmal vor den offenen Gräbern der Toten halt.
Ein Lehrer bereitete die Einstimmung für den Religionsunterricht in einer 7. und 8. Knabenklasse mit den Worten: "So Buben, jetzt könnt ihr tun was ihr wollt, jetzt kommt der Schwarze." - Eine Glaubensstunde in der Fortbildungsschule leitete ich mit den Worten ein: "Wir wollen heute etwas über den Papst und die Regierung der Kirche hören". Der Satz wurde mir von einem "Hitler-Jungen" abgeschnitten: "Geh, lass uns doch von dem römischen Pfarrer unser Ruah."
Der Schulleiter, bei dem ich mich nach zahlreichen ähnlichen Vorkommnissen einmal beschwerte verwies mich an den "HJ-Führer". Ein Schüler in Uniform verließ während des Unterrichts seinen Platz, spazierte durch das Klasszimmer und rief mir zu: "Ja, do konnst gor nix macha, mir san bei der HJ."
Nur dumme Spielereien?
Im unweit von Wolfratshausen gelegenen Linden verbrannte ein mit den üblichen "Parteiwürden" ausgestatteter Lehrer den Schülern mit einer glühenden Zigarre die Hände. Wiederholt ließ er auf dem Boden liegend ortbildungsschülerinnen über sich hinweggehen, um sich anzugeilen.
Auf anhaltendes Drängen der Eltern hin wurde er vom Ortsgeistlichen angezeigt und vom Gericht in München "wegen dummer Spielereien" zu einer unerheblichen Gefängnisstrafe verurteilt. Man konnte aber nie so recht erfahren, ob er die Strafe verbüßt habe, wohl aber, dass er nach seiner Versetzung aus Linden zum Hauptlehrer befördert wurde und nach Nürnberg kam.
In Münsing fiel einem Arzt eines Tages auf, dass sein Bub ("HJ-Pimpf") nicht mehr recht sitzen konnte. Auf die Fragen des Vaters, was denn fehle, verweigerte der Sohn hartnäckig jede Auskunft. Die erzwungene Untersuchung ergab eine Erkrankung, die von unsittlichen Handlungen herrührte. Es stellte sich heraus, dass der "HJ-Fähnleinführer", ein Homosexueller, die ihm anvertraute Jugend in übelster Weise missbrauchte und ihnen unter Bedrohung mit Erschießen Schweigen gegenüber ihren Eltern gebot. Auch dies nur einiges aus vielem. (...)
Einmal hielt mir ein Polizeibeamter vor: Ich hätte auf der Kanzel gesagt, dass der "BDM" die Jugend verderbe. Nach einigem Besinnen fiel mir ein, dass ich einige Zeit vorher in einer Predigt davon sprach, dass ein Mädchen nur dann eine gute Frau und Mutter werden könne, wenn es tief religiös erzogen und im Haushalt geschult wird. Sport und Spiel und Vereine sind Nebensache.
Diese Anzeige wurde von einem Chorsänger erstattet, der früher Wert darauf legte, als guter Katholik zu gelten. Er fiel kurz danach beim Frühstück vom Schlag gerührt tot vom Stuhl herab, so dass die Sache einschlief.
Beichtgeheimnis ist staatsfeindlich
Als ich einmal in einer Predigt davon sprach, dass nun die kirchenfeindliche Einstellung der Zeit hinreichend damit bloßgelegt sei, dass in einer offiziellen Wochenzeitung das Beichtgeheimnis als "staatsfeindliche" kirchenpolitische Maßnahme verhöhnt werde, wurde ich zum Landrat gerufen.
Er hielt mir vor, es sei unerhört, es stifte Unruhe, solche Dinge auf der Kanzel zu besprechen, überdies sei es ganz unmöglich, dass derlei in einer offiziellen Zeitung gestanden habe. Ich wies auf den Untertitel des "Schwarzen Korps" hin: Offizielles Organ der deutschen Polizei.
Darauf erwiderte der Landrat, wenn dem auch so sei, so sei es trotzdem Aufwiegelung, auf dem Land, wo kein Mensch dieses Blatt kenne, davon zu sprechen. Ich bemerkte weiterhin, dieses Blatt sei überall in Wolfratshausen käuflich und sogar öffentlich angeschlagen. Die Antwort des Landrates: Ich sei überhaupt in allem staatsfeindlich tätig, und die Kreisleitung bestehe darauf, dass man im Wiederholungsfall schärfstens gegen mich vorgehen werde.
Wenn ich am Grab eines "PG" von seiner Bekehrung und vom Empfang der Sterbesakramente sprach, hieß es, der Pfaffe habe den Kranken durch seine Quälereien höchstwahrscheinlich gezwungen, oder aber es sei wahrscheinlich gar nicht wahr; der Tote könne ja nichts mehr sagen. Vor der Beerdigung eines "PG" erklärte ein "SA-Führer" seiner Horde: "Wenn der Kooperator nur ein Wörtchen sagen sollte, dann werfen wir ihn ins Grab hinein."(...)
Am schlimmsten erging es dem Gesellenverein. Seine Stärke von ca. 50 Mitgliedern in den Jahren 33/34 war den nur langsam Fuß fassenen NS-Organisationen, "SA" und "Arbeitsfront", ein Dorn im Auge. Wie alle Versammlungen, so mussten wir auch die Hauptversammlung Anfang des Jahres 1935 beim Bürgermeister zur Genehmigung anmelden.
Es kam bis zum Zeitpunkt des Beginnes weder eine Genehmigung noch eine Ablehnung. Beim Betreten des Lokals (Nebenzimmer des Löwenbräu) sah ich außer den Gesellen noch eine Gruppe von uniformierten SS-Leuten. Sie waren aus München herbeigeholt worden.
Unter ihnen befand sich eines der übelsten Elemente der Nazis in Wolfratshausen. Nach einiger Zeit erschien der Bürgermeister selbst. Ich wollte die Versammlung unter diesen Umständen ohne schriftliche Genehmigung nicht halten und teilte dies meinen Gesellen mit. Daraufhin erklärte mir der Bürgermeister, er bestehe auf der Abhaltung.
So nahm die Versammlung kurz und offiziell ihren Ablauf. Hernach riet ich meinen Leuten, möglichst bald nach Hause zu gehen und verließ mit dem größten Teil der Leute selbst den Saal. Drei Leute blieben noch länger.
Nachdem auch sie gegangen waren, folgten ihnen die SS-Leute, zwangen sie, zu ihnen in Autos zu steigen, fuhren sie über die Isar in Richtung Großdingharting und schlugen sie im Wald. Am ärgsten misshandelten sie einen evangelischen Jungmann, der sich dem Gesellenverein nur gastweise angeschlossen hatte. Das Ergebnis der Anzeige beim Landratsamt war ein generelles Versammlungsverbot für den Gesellenverein Wolfratshausen, weil dieser die Ruhe und Sicherheit gefährde. (...)
Einige Tage hernach jedoch, am 1. April 35 wurde der Senior des Vereins, Adolf Reiser, einer von den aufrechten Christen,
wie sie einem selten begegnen, von der Arbeitsstelle zurückgekehrt, verhaftet, mit der Begründung, er habe mit der Einladung der Mitglieder zu einer Familienwoche das Versammlungsverbot umgangen. Durch eine sofort veranlasste Unterredung der Oberhirtlichen Stelle mit der Gestapo gelang es, Reiser nach dreitägiger Haft freizubekommen.
Schläge auf offener Straße
Aber die Verfolgung ging weiter. Am 15. August 35 wurde ich am hellen Tag auf offener Straße von einem erneut herbeigeholten Rollkommando der SS gestellt. Es waren etwa 10 Leute mit Pistolen und Gummiknütteln bewaffnet. Sie fragten mich: "Sind sie der Präses?" Ich sagte: "Welcher?" Die Antwort waren Schläge auf Kopf und Schläfen. Da sagte einer: "Sie sind verhaftet, gehen sie mit in diesen Hausgang." Ich weigerte mich energisch und bat Reiser, der neben mir stand, die gegenüberliegende Gendarmeriestation um Hilfe zu ersuchen.
Inzwischen drang ich bei den SS-Leuten darauf, mir den Haftbefehl zu zeigen. Sie antworteten mir, das sei nicht nötig, sie seien selber Polizei. Reiser kam mit dem Bescheid von der Polizeiwache zurück: "Da kann man nichts machen."
Da Feiertag war, sammelten sich in kurzer Zeit ziemlich viele Straßenpassanten an, die ihre Erregung zum Teil nur schwer verbergen konnten. Dadurch anscheinend eingeschüchtert zogen sich die SS-Banditen zurück mit den Worten: "Wir kriegen dich schon noch." Eine Anzeige wäre ebenso zwecklos gewesen wie im ersten Fall, darum unterließ ich sie.
Ein Jahr später, im August 36 wurde ich durch einen Polizeibeamten in das Amtsgericht Wolfratshausen zu einer Vernehmung geladen. Ein Herr, der sich als Staatsanwalt ausgab, erklärte mir, ich könnte ruhig meine Erlebnisse vom 15. August 35 zu Protokoll geben, ja, dies sei sogar meine Pflicht. Die Leute, die mich überfallen hätten, seien sämtlich hinter Schloss und Riegel, sie seien Provokateure gewesen, die das Ansehen der Polizei schädigen wollten. Im neuen Deutschland gebe es so etwas nicht mehr. Dann wurde ich zwei Stunden vernommen.
In Wirklichkeit ist von den SS-Leuten niemand verhaftet oder bestraft worden. Ich konnte später sogar in Erfahrung bringen, dass sich einer dieser Helden in einem Kaffeehaus in München ("Brennessel") damit brüstete, dass ihm der damalige Gauleiter Adolf Wagner bei einem Empfang auf die Schulter klopfte und ihn für "sein schneidiges Vorgehen
gegen die Schwarzen in Wolfratshausen" belobigte.
Dämonischer Häuptling Adolf
Meine persönlichen Erlebnisse zusammen mit den heute allen bekannten Äußerungen und Wirkungen des Hitler-Systems auf kulturell-religiösem und staatlich politischem Gebiet (...) führten mich früh auf eine klare Linie der totalen Ablehnung des Nazitums. Ein Consortium von Verbrechern und Abenteurern hatte sich unter der Führung eines dämonischen Häuptlings unter Ausnützung der Notlage des deutschen Volkes durch Lüge, Mord und brutale Gewalt an die Macht gedrängt.
Nach Erreichung dieses Ziels steigerte diese Bande mit raffinierten Organisationsmethoden und Zwangsmitteln ihre verbrecherische Tätigkeit ins Unermessliche. Der Begriff "rechtmäßige Regierung" konnte auf den Hitlerismus darum keine Anwendung finden. Ihn zu bekämpfen oder zu seinem Sturz beizutragen, hielt ich vor meinem Gewissen nie für Hochverrat sondern für meine Pflicht als Katholik, Priester und Staatsbürger.
Wohl konnte dieses Unterfangen unklug, aussichtslos und gefährlich erscheinen, umso mehr für jemand, der beruflich exponiert war und die Aufmerksamkeit der Gestapo durch die besonderen Umstände besonders auf sich gelenkt sah. Doch verlieren solche Einwände in einer so wichtigen Sache vor dem Gewissensurteil des christlichen Menschen ihre Bedeutung. (...)
Diese Erwägungen bewogen mich im Jahr 1935 einem Mitglied der damals im Entstehen begriffenen bayerischen Widerstandsbewegung die Zusage meines Interesses zu geben. Der Mann war durch meine Erlebnisse und meine Einstellung auf mich aufmerksam geworden.
Der Bund hatte sich die Bewahrung des bayerischen Gedankens zum Ziel gesetzt. Es fanden sich in ihm monarchistisch gesinnte, aber auch viele demokratisch orientierte Leute aus dem früher christlich eingestellten Lager. Ihre Zahl stieg auf 5000.
Ich habe vor und besonders während meiner Gefangenschaft viele von ihnen kennengelernt. Es waren durchwegs ideale Menschen, keiner vorbestraft, aus allen Schichten und Richtungen der Bevölkerung.
Es konnte nicht anders sein, denn Aussichten auf Reichtum und Ehrenstellungen gab es nicht, nur Wagnis und Gefahr.
Geldmittel konnten nur in bescheidenem Maße aus kleinen Spenden der Mitglieder selbst aufgebracht werden.
Von verschwindenen Ausnahmen abgesehen waren Leute aus vermögenden Kreisen für solche Aufgaben nicht zu finden.
Nach meiner Versetzung nach München im Jahre 1938 kam ich erstmals bei einigen Besuchen der mir bekannten Familie Pflüger mit einem kleineren Kreis unserer Leute zusammen. Unter ihnen befand sich zu dieser Zeit schon ein gerissener Verräter, der Gestapo-Spitzel Fischer.
Dieser ältere Herr mit biederem Aussehen gab sich als ehemaliger Mitarbeiter Dr. Gerlichs aus, warb sogar selbst Mitglieder für die Widerstandsgruppe und gewann so rasch das Vertrauen. Wie wir später erfuhren, hat Fischer zu gleicher Zeit wöchentlich einen handschriftlichen Bericht über alles ihm Erreichbare einschließlich harmlose Witze an die Gestapo gegeben. (...)
Festnahme und Gefängnis
Kurz vor Beginn des Krieges, in den ersten Augusttagen des Jahres 1939, erfuhr ich von den ersten Verhaftungen der Leute unseres Kreises. Eine Flucht ins Ausland, deren Gelingen von Tag zu Tag fragwürdiger wurde, da ich mich schon von der Gestapo "unauffällig" beobachtet wusste, hätte meinen Vater und meine Schwester in größte Gefahr gebracht.
Als ich von einem kurzen Landaufenthalt am 12. August 1939 nach München zurückkam, erfuhr ich im Hotel Europäischer Hof am Fernsprecher durch das Pfarramt, dass bereits am Morgen "Besuch" bei mir gewesen sei.
Es war ein Samstag und am folgenden Sonntag war in St. Maria Ramersdorf die kirchliche Feier des 25jährigen Priesterjubiläums des HH. Stadtpfarrers Kifinger angesetzt. Gegen 5 Uhr abends ging ich nach einem kurzen Besuch
in unserer Gnadenkirche zunächst nicht in meine Wohnung, sondern ins Pfarrhaus.
Hier hatte ich mich kaum zu einer kleinen Lagebesprechung niedergesetzt, als zwei Gestapo-Beamte in Zivilkleidung das Zimmer betraten und mich nach Vorzeigung einer Marke festnahmen.
Auf dem kurzen Weg in meine Wohnung begann einer dieser Beamten bereits mich zu verhören: "Wer ist Ludwig?" Ich konnte keine Antwort geben auf eine so aus jedem Zusammenhang gerissene Frage. Der Beamte sagte zynisch: "Na, Sie werden es schon noch lernen, sich zu besinnen."
Wäsche, Kamm und Seife
Nun nahm ich von meiner Schwester Abschied und trat mit einem Köfferchen, in dem nur die notwendigsten Habseligkeiten, wie Wäsche, Kamm und Seife, und das Brevier (Gesang- und Gebetsbuch des Priesters, d. Autor)
und das Neue Testament Platz finden durften, den Weg in das Dunkel einer fast sechsjährigen Gefangenschaft an. (...)
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde ich dann in das Gefängnis Stadelheim gebracht. (...) Am kommenden Sonntag brachte mir der Gefängnispfarrer ein Buch. (...) Der Inhalt dieses Buches wie die erschrockene Miene des Geistlichen bestätigten mir die Ahnungen, ich müsse nun nicht nur mit meiner Freiheit, sondern auch mit dem Leben abschließen. Am darauffolgenden Montag wurde ich wieder in das kleine Gefängnis der Gestapo im Wittelsbacher Palais gefahren. Vor der Fahrt sagte mir der Beamte: "So, jetzt werden wir dich wie eine reife Zitrone auspressen."
In den kommenden Monaten bewohnte ich eine kleine Zelle im Kellergeschoß des Gestapogefängnisses zusammen mit einem älteren jüdischen Geschäftsmann aus München. Aus einem Gesuch, bei dessen Abfassung ich ihm half, ersah ich, dass er auf die Anzeige eines Geschäftskonkurrenten hin wegen Verdachts auf "Rassenschande" in Haft gekommen war.
Die Verpflegung während dieser Zeit war gut und ausreichend. Die Behandlung richtete sich nach Veranlagung, Laune, dem jeweiligen Grad der Besoffenheit und der Einstellung der SS-Aufseher. Während der vier Monate kam ich nur zweimal je ca. 45 Minuten lang ins Freie.
Was mir diese erste Zeit zur Hölle machte, waren die Verhöre in der Gestapo selbst. Vier Wochen hindurch wurde ich nahezu täglich vom Morgen bis zum Abend, einige Male bis 10 Uhr vernommen. Drei Kommissare besorgten diese Arbeit, hin und wieder schaltete sich auch einer der "Regierungsräte" ein.
Gewalt lähmt die Stimmung
Zunächst erschrak ich über die eingehenden Informationen der Gestapo. Der Beamte las mir aus handgeschriebenen Blättern seitenweise Berichte über meine persönlichen Beziehungen und meine Tätigkeit vor. Freilich eignete sich nur wenig daraus zu einer mühseligen Konstruktion einer Belastung im Sinne des Gesetzes. Daran änderte auch die mitunter theatralische Aufbauschung nichts. (...)
In den Zeiten zwischen den Verhören war das Leben im Gestapo-Gefängnis schwer und eintönig. Die vollständige Hilflosigkeit und Unsicherheit gegenüber der Gewalt und dem Unrecht legte sich lähmend auf die Stimmung. Unbeschwerte Unterhaltung gab es nicht. Doch geschahen zuweilen Abenteuer.
Einem unserer Leute gelang es einmal, einen Brief über die Küche hinauszuschmuggeln. Da sich der Adressat in seiner Antwort, die über den Amtsweg hinein kam, darauf bezog, kam die Sache auf. Vier Wochen strenger Arrest bei Wasser und Brot und hartem Lager waren die Strafe dafür. Täglich sahen wir am Morgen den "Dachauer Wagen" vollbesetzt durchs Tor hinausfahren.
Nach dem Attentat am 9. November 1939 (im Münchner Bürgerbräukeller, d. Autor) zeigte mir ein Aufseher mit bestürzter Miene die Zeitung: "Das wird auch für euren Verein unangenehme Folgen haben." Drei Tage hernach wurde ich mit noch dreien unserer Leute wegen Überfüllung des Gestapo-Gefängnisses mit sämtlichen Angestellten des Bürgerbräu-Kellers in die Strafanstalt München-Stadelheim in sogenannte Schutzhaft verbracht. (...) Von diesem 12. November 39 ab war ich in ständiger strenger Einzelhaft bis Ende Juni 1944, fast 5 Jahre. (...)
Elf Stunden täglich Tütenkleben
Die Gefangenenarbeit bestand elf Stunden täglich in der Anfertigung von Papiertüten. Sie bedeutete besonders für Leute von Bildung und geistiger Regsamkeit keine Verkürzung der Zeit, sondern eine indirekte, furchtbare Folter. Wir politischen Schutzhäftlinge waren vom Besuch des Gottesdienstes ausgeschlossen, durften keine zusätzlichen Lebensmittel empfangen und nicht rauchen.
Die Kost war in dieser Anstalt zu dieser Zeit schon sehr wenig, schlecht und von geringem Nährwert. Ich erfuhr, was Hunger ist. Besuche von Angehörigen waren sehr selten, durften nur fünf Minuten dauern und wurden streng überwacht. Als meine Schwester bei der Gestapo einmal eine Sprechkarte beantragte, erkundigte sie sich bei den Beamten danach, wie es mit mir stehe. Sie erhielt die Antwort: "Da brauchen sie sich gar nichts mehr zu denken, ihr Bruder wird geköpft, der wollte ja die Regierung stürzen."
Kurz vor Weihnachten 39 ging ein Gerücht um, es würden zum Fest Leute aus unserem Kreis entlassen. Als meine Schwester um diese Zeit um eine Besuchserlaubnis ersuchte, wurde ihr nun gesagt, es sei nicht mehr nötig, denn ich würde dieser Tage frei. Da ich am Hl. Abend noch nicht nach Hause kam, versuchte sie es nochmals mit einem Besuch
im Gefängnis. Sie wurde brutal abgewiesen. Meine Schwester erlitt damals einen Nervenzusammenbruch (...).
Die Hausordnung der Gefängnisse sah auch für das trauteste aller Feste keine Ausnahme vor. Wie sonst an Sonnabenden und Sonntagen entfiel am Abend die warme Suppe. Das Abendessen bestand an solchen Tagen aus einem Stück Brot und etwas Leberpressack, und wurde am Mittag schon ausgegeben und dann auch meist gleich gegessen.
"Stille Nacht" - wie in der Kirche
Wie sonst brannte auch am Hl. Abend kein Licht in der Zelle. Diese Maßnahme wurde mit dem Luftschutz begründet. Nur eines konnte man uns nicht nehmen, die Nähe zu Gott. Von irgendwoher hatte ich ein Kerzlein und ein Zündholz erhalten; kaum hatte ich es angezündet, da halte aus irgendeiner Zelle eine Stimme durch die Gänge: "Stille Nacht ..." Andere klangen dazu, vierstimmig, es hätte in der Kirche nicht schöner sein können (...).
Am 7. Januar 1940 wurde ich in das Untersuchungsgefängnis Neudeck überstellt. Die Gestapo hatte inzwischen die Protokolle an den "Volksgerichtshof" in Berlin weitergegeben. Dieser veranstaltete im Lauf des Januar und Februar 1940
noch einmal Vernehmungen. (...)
Die Art der Verhöre war ruhiger und sachlicher, freilich auch hinterlistiger als in der Gestapo. Vom Abschluss dieser Vernehmungen war ich viereinhalb Jahre "Untersuchungsgefangener", es fanden jedoch keine Verhöre mehr statt.
Die Haft in der kleineren Untersuchungsanstalt Neudeck war in manchem erträglicher als in der großen überfüllten Strafanstalt Stadelheim. Die Zelle war sauber und enthielt außer Bett, Tisch und Stuhl auch einen kleinen Spind, einen Spiegel und ein Wandbild, was ihr einen Hauch von Wohnlichkeit verlieh. Von Ausnahmen abgesehen war das Benehmen der Aufseher nicht mehr grob und verächtlich, sondern ruhig; manche Beamte zeigten Teilnahme und grüßten freundlich. (...)
Nach dem endgültigen Abschluss der Vernehmungen übergab der "Volksgerichtshof" die Briefzensur und die Besuchskontrolle an einen Ermittlungsrichter des Münchner Amtsgerichts. Dieser war etwas großzügiger, ließ zu, dass ich eigene Bücher lesen konnte und nach einigen Jahren meine Angehörigen außerhalb der Gittervorrichtung sprechen konnte, freilich unter ständiger Aufsicht. (...)
Treue Pfarrgemeinde
Der Wahrheit zuliebe und aus der Verpflichtung tiefer Dankbarkeit denke ich an die Überraschung zurück, als ich inne wurde, wie sich die Liebe der Pfarrangehörigen von St. Maria Ramersdorf durch die unerbittlichen Bestimmungen des Hasses und die eisernen Gittertüren einen Weg schlug, um mir zu helfen.
Einem Mitglied der Pfarrjugend, das zugleich als Sekretärin im Münchner Amtsgericht arbeitete, gelang es, die Erlaubnis zu gelegentlichen Besuchen bei ihrem Chef zu erhalten. Über diesen Weg erhielt ich bis zum Jahr 1944 laufend Nachrichten aus dem pfarrlichen Bereich und in der sehr bald einsetzenden Hungerzeit sehr willkommene zusätzliche Lebensmittel, zu deren Beschaffung sich eigens ein Kreis von Frauen bereitgefunden hatte. (...)
Es gab aber doch von Seiten des Gerichts, der Anstaltsbehörden, ja selbst der Gestapo einen Unterschied in der Behandlung der Gefangenen. Da hatten einige die Erlaubnis, sich selbst mit eigenem Apparat zu rasieren. Die meisten wurden einmal in der Woche von einem Gefangenen mit einer Haarschneidemaschine rasiert.
Gelegentlich erfuhr ich nun während dieser Prozedur, dass die besagte Maschine auch bei geschlechtskranken Gefangenen an besonderen Körperteilen verwendet wurde. Freilich wurde sie in diesen Fällen "hernach abgewischt und mit einem anderen Einsatz versehen". Daraufhin habe ich wegen meiner empfindlichen Haut um Rasiererlaubnis nachgesucht. Die eigentliche Begründung zu bringen, wäre nicht ratsam gewesen. Mein Gesuch wurde abgelehnt. (...)
Keine Verhandlung - keine Entlassung
Nach geraumer Zeit haben mir gut gesinnte Menschen nahegelegt, ich möge einen angesehenen Rechtsanwalt ersuchen,
sich beim "Volksgerichtshof" in Berlin für mich zu verwenden. Nach dem Urteil der Vernunft erschien so etwas zwecklos,
ja vielleicht gefährlich, weil es die Aufmerksamkeit der Feinde erregte.
Jedoch Wunsch und Hoffnung waren noch nicht gestorben. Ich habe dem Anwalt eine Menge Material zur Entkräftung der vom Gericht gegen mich erhobenen Vorwürfe vorgelegt (...). Nach etwa zwei Monaten besuchte mich der Herr wieder und erklärte mir, man habe ihm in Berlin gesagt, mein Fall werde demnächst gerichtlich geregelt, und ich könnte auf baldige Befreiung hoffen, da man ein Strafausmaß von drei Jahren annehme. Auch dies entsprach nicht den Tatsachen.
Drei Jahre meiner Haftzeit waren längst um, und ich hörte nichts von einer Verhandlung. So habe ich selbst ein ausführlich begründetes Gesuch an den "Volksgerichtshof" um Haftentlassung oder eine baldige gerichtliche Entscheidung gesandt. Nach zwei Monaten erhielt ich von dort ein Schreiben folgenden Inhalts: "Die ihnen von ihrem Anwalt gemachten Mitteilungen (...) entbehren jeder tatsächlichen Grundlage. Da die Gründe, die zum Haftbefehl geführt haben, fortbestehen, findet eine Haftentlassung nicht statt."
Diese Erlebnisse brachten mir die vollständige Hilflosigkeit gegenüber der Verlogenheit und brutalen Gewalt im Mantel des Rechts erst ganz zum Bewusstsein. Sie führten in Verbindung mit der immer schwerer drückenden Einzelhaft zu einer ständigen latenten Angst und im vierten Jahr der Haft zu einer sich steigernden schweren Nervenkrise.
Die Zelle war dunkel, der Aufenthalt in der "frischen Luft" des Gefängnishofes viel zu kurz. Sonne gab es für uns überhaupt nicht. Im Winter 1942 erwärmte sich der Heizkörper vormittags und nachmittags für je zwei Stunden so, dass man in seiner unmittelbaren Nähe merkte, dass geheizt war.
Da ich mit zunehmender Haftzeit viel an Schlaflosigkeit litt, ging ich täglich bis 11 Uhr nachts auf und ab, im Winter 7 Stunden lang, 5 Schritt auf, 5 Schritt ab. Während der ersten Jahre war mir diese Zeit sehr kostbar. Da baute ich mir meine eigene innere Welt, da lernte ich auch den Wert des Gebetes kennen. Vom vierten Jahr ab verlor ich die Freude am Lesen und die Gedanken kreisten mehr und mehr um dieselben Dinge. Es entstand ein Kampf mit dem kommenden Wahnsinn (...).
Ohne Schutz vor Fliegerangriffen
Eine weitere Belastung bildete das besondere Erlebnis der Fliegerangriffe im Gefängnis. Es gab für Gefangene keine Schutzräume. Und zwar aus Prinzip nicht, was aus einer Anordnung des damaligen Generalstaatsanwalts hervorgeht. Danach waren nach dem Einsetzen der schweren Angriffe die leicht kriminellen Gefangenen in den unteren,
die schweren kriminellen in den mittleren und die politischen in den oberen Stockwerken unterzubringen.
Eine Hilfeleistung durch Beamte und Löschkommandos war für die politischen Gefangenen in der gleichen Anordnung ausdrücklich untersagt, mit der Begründung: An der Rettung dieser Leute haben wir kein Interesse.
Damals wurde ein Hauptmann in eine mir benachbarte Zelle gesperrt, der auf mehreren Kriegsschauplätzen vieles erlebt hatte. Beim ersten Fliegerangriff brüllte er wie ein Stier. Hernach sagte er mir: Unter all dem Scheußlichen, was er gesehen habe, sei diese Wehrlosigkeit im versperrten Raum das Schrecklichste.
"Verbrecherkonsortium"
Aus menschlichem Mitempfinden mit meinem damaligen Zustand wagte es seinerzeit der uns gut gesinnte Verwalter der Anstalt Neudeck, mir die Arbeit in der Gefängnisbücherei zu übertragen. Damit wäre ich wenigstens für einige Stunden des Tages aus der Enge der Zelle herausgekommen. Doch nach einigen Wochen schon wurde mir diese Vergünstigung von dem Vorgesetzten Firmkäs wieder entzogen.
Außer der Lust an der Schikane gegen den Geistlichen in mir erschien mir als einer der wesentlichen Gründe für diese vollständige Absperrung die Absicht, mir ja jeden Einblick in die Vorgänge und in die Schicksale der Mitgefangenen vorzuenthalten. Dies gelang auch in dieser Zeit, wenn auch nicht ausnahmslos.
Geraume Zeit nach meiner Einlieferung kamen zwei Geistliche (wegen krimineller Delikte, Sittlichkeit) dorthin. Von einem davon, anscheinend dem Anstifter, hatte jeder Beamte und jeder Gefangene, der ihm begegnete, den bestimmten Eindruck, dass er geistesgestört war.
Er bestand zum Beispiel im Gefängnis noch hartnäckig auf der Ansicht, er habe nichts Schlechtes getan, sondern in göttlichem Auftrag gehandelt. Er suchte uns bei jeder Gelegenheit davon zu überzeugen, dass am 8. Dezember 42 eine große dreitägige Finsternis käme, als Gericht über den Nazismus und die Gottlosigkeit.
Schließlich schrieb er einen langen Brief an die Generalstaatsanwaltschaft, in dem er dieser den Auftrag erteilte, das "Verbrecherkonsortium", das sich derzeit Regierung nennt, zu verklagen und zum Tod zu verurteilen.
Daraufhin wurde er auf Veranlassung dieser Behörde zu vier Wochen strengem Arrest verurteilt. Als er unter dieser Strafe schwer abmagerte, brachte ihm ein gut gesinnter Beamter etwas Brot in die Zelle. Dies wies er zurück und zeigte obendrein den Beamten bei seinen Vorgesetzten deswegen auf dem Dienstweg an. Den erwähnten Brief hatte er unterschrieben: "Karl Dürr, der große Monarch des kommenden Reiches".
Dieser Mann wurde wohl auf die Veranlassung seines Verteidigers vor der Verhandlung zur Untersuchung in die Münchner Nervenklinik gebracht. Der andere Geistliche auch. Ob die in dieser Klinik an den beiden Patienten vorgenommenen schweren Misshandlungen (wechselndes Übergießen des Körpers mit heißem und eiskaltem Wasser, Püffe und Tritte auf den Leib) und die Verhöhnungen der beiden vor dem ganzen Auditorium vom medizinischen Standpunkt aus notwendig war, kann ich nicht beurteilen.
Die Untersuchung ergab jedenfalls, dass beide, auch Dürr, normal und für ihre Handlungen voll verantwortlich seien.
Es folgte eine Verhandlung vor einem der Münchner "Sondergerichte". Das Urteil lautete für Dürr auf 14 Jahre
und für den anderen Geistlichen auf 7 Jahre Zuchthaus.
Es erschien einem der Gerichtsbeamten als zu milde, und er beantragte Wiederaufnahme des Verfahrens vor einem "Sondergericht" in Nürnberg. Dort wurde dann Dürr zum Tode verurteilt und nach einem Vierteljahr enthauptet. (...)
Wieder in strenger Einzelhaft
Im Oktober des Jahres 1942 wurde ich ins Gefängnis an der Corneliusstraße verlegt. Dort war ich, wieder in strenger Einzelhaft, eineinhalb Jahre untergebracht. Als Vorwand für diese Übersiedlung wurde Raummangel angegeben. Der wirkliche Grund war ein anderer. Firmkäs war es im Laufe der Zeit wohl zu Ohren gekommen, dass ein paar gut gesinnte Beamte mich gelegentlich auf einen Sprung aufsuchten, um mir etwas Trost, auch manchmal einige Zigaretten zu bringen.
Dies konnte er am besten damit unterbinden, dass er mich ins Corneliusgefängnis brachte, das unter seiner ganz persönlichen Leitung ein Musterbetrieb nazistischen Strafvollzugs war (er wohnte selbst im Haus) und dessen Aufseher ihm restlos und ängstlich ergeben waren. (...)
Doch nach einigen Wochen lernte ich in einigen Aufsehern sehr liebe Menschen kennen. (...) Freilich konnte das die Schwere der Haft nur unwesentlich mildern, denn die Hausordnung war sehr streng, der Ton der nazistischen Aufseher unpersönlich, kalt zuweilen brutal, der Haftraum war viel kleiner, die Fenster nur schmale Schlitze und die Luft wegen des Klosettkübels sehr schlecht. (...)
Bei einem der damaligen Luftangriffe gerieten die Häuser rund um die Anstalt und diese selbst in Brand. Am bedrohlichsten waren die Stichflammen aus der wenige Meter entfernten, mit Explosivstoffen gefüllten alten Kaserne. Es wurden die Zelltüren für wenige Minuten geöffnet und die Gefangenen angewiesen, an der Türe stehen zu bleiben.
In solchen Nächten war an eine Minute Schlaf überhaupt nicht zu denken. Bis zur Mitternacht ließen mich in diesen Monaten der Hunger und die Nervenüberreizung nicht zur Ruhe kommen. Die eingeschlagenen Fensterscheiben konnten nur durch Papier ersetzt werden, so dass nun die Zelle auch wochenlang ausgekühlt war. (...)
In den ersten Apriltagen des Jahres 44 wurde ich überraschenderweise wieder ins Untersuchungsgefängnis Neudeck zurückgebracht. Der öde Gleichlauf des Strafvollzugs hatte hier, wie mir auffiel, inzwischen eine Wendung zum Schlechteren genommen. Einige Aufseher hatten es sich angewöhnt, Gefangene aus geringen Anlässen zu schlagen.
In der Langeweile eines Festtages schaute ein Grieche zum Zellenfenster hinaus. Er wurde darob verprügelt wie ein Hund. Einem anderen wurde eine Frage an den Beamten mit einem Schlag mit dem Schlüsselbund ins Gesicht beantwortet. (...)
Nach fünf Jahren ein Prozess
Auf den 13. Juni, nahezu fünf Jahre nach der Festnahme, wurde die gerichtliche Verhandlung anberaumt. Die aufgebauschte Anklageschrift beschuldigte in sehr scharfem Ton neun Leute aus unserer Gruppe staatsfeindlicher Bestätigung, darunter drei, Pflüger Heinrich, Fahrner und mich, der Vorbereitung zum Hochverrat.
Leider kann ich den mich betreffenden Abschnitt nicht wörtlich anführen, weil meine Aufzeichnungen bei einem Fliegerangriff verloren gegangen sind. Wie schwach die Unterlagen waren, beweist die Anführung des so genannten Annahmeparagraphen § 89, nach welchem der Richter befugt war, in Ermangelung stichhaltiger Beweise, Strafen nach eigenem Ermessen zu verhängen.
Die Verhandlung selbst wurde am Dienstag nachmittag, 13. Juni 1944, eröffnet. In blutroten Roben mit aufgesticktem "goldenen Hoheitszeichen" betraten die Richter den Schwurgerichtssaal des Münchner Justizpalastes. Über dem Gericht hing ein überlebensgroßes Bild des "obersten Gerichtsherrn", das die brutalen Züge dieses Massenmörders sehr unmissverständlich hervorhob. (...)
Der Vorsitzende Richter war ein Preuße, der Oberreichsanwalt ein Sachse mit einem Höcker, der Schriftführer ein kleiner verschlagener Österreicher. Die zwei Beisitzer, ein General der Flieger und ein Führer des Arbeitsdienstes, in ihren militärischen Uniformen milderten durch ihre menschlicheren zuweilen auch schläfrigen Mienen das abschreckende Bild. (...)
Den zweiten Tag füllten die Plädoyers der Anwälte. (...) In den späten Nachmittagsstunden entspann sich eine fast erheiternd wirkende Szene. Unter den wenigen Zeugen war an diesem Tag unser Verräter und Spitzel Fischer anwesend. Seinem niederen Verrat in den Jahren 38 und 39 hatte er mit einer seltenen Gemeinheit die Krone damit aufgesetzt, dass er nach der Gefangennahme seiner Opfer zu deren Angehörigen hinging und versprach, er könne durch seine Verbindungen in Berlin die Befreiung der Gefangenen erreichen.
Es mangle ihm nur an dem nötigen Geld zur Fahrt dahin. Bei meinen Angehörigen versuchte er diesen Betrug zweimal.
Sie waren auf meine vorherige Warnung hin nicht darauf hereingefallen. Nun hatte ich während meiner Haftzeit einmal in einem Schreiben an den "Volksgerichtshof" unter anderen Gründen zu meiner Entlastung auch angeführt, ich könne es nicht glauben, dass ein deutsches Gericht einen Menschen auf das Zeugnis eines so minderen Betrügers hin ins Unglück stoße.
Dazu musste Fischer nun in der Verhandlung Stellung nehmen. Er leugnete alles, sogar dass er meinen Vater kenne;
mich irgendwann einmal gesehen zu haben, daran konnte er sich gerade noch erinnern. Für das Gericht wurde die Sache schwierig und zur gänzlichen Blamage, als vier Anwälte mit schlüssigen Beweisen über den Hauptzeugen Fischer herfielen und ihn fünfmal des Betruges überführten.
Statt nun den Schein zu wahren und entrüstet von Fischer abzurücken, setzte der Vorsitzende die Einvernahme fort. Und Fischer leugnete weiter, er leugnete alles, was er früher schriftlich an die Gestapo weitergegeben hatte. Er konnte dies, denn das Aktenmaterial gegen uns war längst den Bombenangriffen auf Berlin zum Opfer gefallen. Er soll an diesem Abend noch von der Gestapo verhaftet worden sein. So verlockend es war, auf diese Vorgänge eine leise Hoffnung zu gründen, so drohend stieg die Befürchtung auf, sie könnten die Mordwut unserer Richter erst richtig geweckt haben.
Todesstrafe beantragt
Der nächste Morgen zeigte es. Die Sitzung begann mit der Beantragung der Strafen durch den Oberreichsanwalt. (...) Er beantragte gegen einige unserer Leute Gefängnis von einem bis zu drei Jahren (einer dieser Angeklagten war fünf Jahre in Untersuchungshaft) und dann, ich hoffte schon im Stillen, nun könne es nicht mehr allzu schlimm werden, beantragte er gegen Pflüger, Fahrner und mich die Todesstrafe, weil solche Leute in der Volksgemeinschaft keinen Platz mehr hätten.
Der Ton dieser Anträge erinnerte an die Art, wie ein Kellner seinem Gast die Speisenfolge vorleiert. Es war 9 Uhr am Vormittag. Mittags besuchte mich meine Schwester. Sie wusste nicht um die Lage. Ich musste mich verstellen und ihr vorsagen, dass alles gut stünde. In Wirklichkeit war nicht mehr viel zu hoffen, vor allem, weil ich wusste, dass von Berlin aus die Todesurteile als fertig betrachtet wurden. So drückte das drohende Urteil schwer auf die kleine Schar in dem käfigartigen Raum, in dem wir Stunden warten mussten, da sich die Richter zur Beratung zurückgezogen hatten. (...)
Dann wurden wir in den Saal gerufen. Die beantragten Haftstrafen blieben, gegen Fahrner wurden 9, gegen Pflüger 5 und gegen mich 7 Jahre Zuchthaus verhängt (...) Ein schriftliches Urteil habe ich nicht erhalten. Die mündliche Urteilsbegründung lautete nicht mehr auf Vorbereitung zum Hochverrat, sondern auf Mitwisserschaft des geplanten Führermords, da in meiner Gegenwart jemand gesagt haben soll, der Hitler gehöre weg. Da ich dies nicht zur Anzeige gebracht hatte, sei meine staatsfeindliche Einstellung erwiesen. Kurz darauf wurden wir ins Gefängnis zurückgebracht.
Schon wieder Stadelheim
Schon am Tag nach der Gerichtsverhandlung wurde ich im überfüllten Gefangenenwagen nach Stadelheim gebracht.
Hier bekam ich sofort Sträflingskleider, wenn man die ausgedienten Drillichfetzen des Militärs so nennen will. (...) Weil das Gefängnis Stadelheim nicht so unter dem unmittelbaren Einfluss des Inspektors Firmkäs stand, wie die anderen Münchner Anstalten, hatte man dort seit Jahren die Leute unserer Widerstandsgruppe an bevorzugten Posten außerhalb der Zelle verwendet. (...) So wurde ich zunächst als Schreiber im Büro verwendet.
Jetzt kam ich in eine größere sogenannte Gemeinschaftszelle, erhielt etwas bessere Sträflingskleider, statt Holzschuhen solche aus Leder und annähernd genügend zu essen. (...) Aber nun merkte ich erst wieder, wie die Last der fünfjährigen Einzelhaft alle Kräfte verzehrt hatte. (...)
Ich kam in Berührung mit der Mordjustiz des "Dritten Reiches". Im Krankenrevier stand ein Register für alle Sterbefälle dieses Jahres, eines für die Hinrichtung mit einem Ordner und ein Verzeichnis aller Gefangenen von Stadelheim mit Ausnahme der weiblichen (...). Diese Bücher hatte ich auf dem Laufenden zu halten. Hinter den Namen der Todeskandidaten hatte ich ein rotes T. hinter den der Hingerichteten ein rotes Kreuz zu setzen. (...)
Wurde ein zum Tod Verurteilter eingeliefert, so musste sofort ein Leichenschauschein für ihn ausgefüllt werden, ungeachtet dessen, dass von da ab bis zur Hinrichtung im allgemeinen noch ein Abstand von drei Monaten bestand. (...) Die Hinrichtungen fanden in diesen Monaten jeden Dienstag nachmittag um 5 Uhr statt. Der kleine Bau, in dem die Leute umgebracht wurden, befand sich in nächster Nachbarschaft zu unserem Trakt, so dass man die Schläge des Fallbeils herüberhörte. Es wurden jedesmal 15 bis 20 Leute geköpft.
Die Leichen der Hingerichteten wurden unmittelbar nach der Enthauptung aus der Anstalt gebracht. In der sogenannten Spülzelle stieß ich einmal auf ein größeres Bündel Bettwäsche, das unmittelbar neben der Öffnung lag, in die der Unrat aus den Klosettkübeln geschüttet wurde. Als ich es aufschlug, sah ich, dass es eine Leiche barg. An ihr habe ich die armseligste Aussegnung meines Lebens vorgenommen.
Dem Sadisten Firmkäs war die Präsenz bei Hinrichtungen Vergnügen. Zeugen haben mir berichtet, dass er eine Stunde vorher schon ungeduldig auf und ab ging und es nicht erwarten konnte, bis es 5 Uhr wurde. Ich selbst habe festgestellt, dass dieser sonst so griesgrämige, kalte Mensch am Dienstag seine heitere Laume kaum verbergen konnte. Seine ausgesprochen sadistische Veranlagung beweist auch die Tatsache, dass er aus Paketen für Gefangene verbotene Lebensmittel, Wurst, Butter und so weiter herausriss, auf den Boden warf und mit den Stiefeln zertrampelte.
Und da soll es Leute geben, die es gerne sähen, wenn dieser Herr nach geschehener Entnazifizierung wieder in den Dienst der Justiz zurückkäme. (...)
Oktober 44, Zuchthaus Straubing
Über die Transportzellen des Gefängnisses im Polizeipräsidium München und des Gefängnisses Regensburg, in denen man wegen des vielen Ungeziefers und der großen Unruhe nicht schlafen konnte, kam ich gerädert und hungrig in Straubing an. Auf dem Weg vom Polizeiauto zum Münchner Bahnsteig wurde ich das erste Mal gefesselt.
Das Zuchthaus war und wurde von Woche zu Woche mehr eine Hölle. Zur Zeit meines Eintritts barg die Anstalt 1000 politische und 300 kriminelle Häftlinge. Sie waren gemischt, ein Unterschied wurde selten, meist zu ungunsten der Politischen, gemacht.Das ganze Haus, Beamte, einschließlich des eigentlichen Leiters (ein Jurist), und Gefangene wurden von dem berüchtigten "Polizeiinspektor" Todt tyrannisiert. Es wurde von ihm erzählt, er sei einer der Aufseher Hitlers
in Landsberg gewesen und sei von diesem aus Dankbarkeit für die gute Behandlung mit dem Posten in Straubing belohnt worden.
Schon an einem der ersten Tage nach meiner Ankunft ließ er mich rufen. Er hatte mein Brevier, um das ich gleich nachgesucht hatte, aufgeschlagen vor sich liegen. Er hatte meine Bleistiftnotizen darin entdeckt, die ich, wie manche andere Geistliche auch, seit mehreren Jahren darin gemacht hatte. Sie waren rein privater Natur.
Mit lauter Eindringlichkeit belehrte er mich, dass so etwas nach seiner Meinung eines Priesters höchst unwürdig sei. Vier Wochen später kam es anders. Ich hatte nach Vorschrift um die Erlaubnis gebeten, eine Karte an meine Angehörigen schreiben zu dürfen, dass sie mir die übrigen Teile des Breviers schicken möchten. Daraufhin zitierte mich Todt vor meinen Mitgefangenen und fragte zynisch, was ich denn eigentlich wolle.
Ich wiederholte meine Bitte strammstehend mit den Händen an der Hosennaht. Er fragte, "wozu brauchen Sie denn das eigentlich?" Ich machte geltend, dass ich katholischer Geistlicher sei und zum Breviergebet verpflichtet. Daraufhin gab er mir zur Antwort: "Sie sind doch kein Priester, Sie sind Zuchthäusler." (...)
Zwangsarbeit im Zuchthaus
Als die Flugzeugwerke in Regensburg zerstört waren, hat man innerhalb der Zuchthausmauern einen Teil dieses Betriebes in Baracken gelegt. In einer solchen hatte ich zu arbeiten, 12 Stunden täglich, sonntags 10 Stunden lang; Gefangene aller Schichten und Bildungsgrade, verschiedener Nationen, Politische, Berufseinbrecher und Zuhälter standen am Schraubstock auf kaltem Betonboden und bogen Röhrchen, feilten und hämmerten. Schweigende, abgemagerte Gesichter.
Ein fetter Aufseher nörgelte den ganzen Tag an den Leuten herum. In der ca. 50 Meter langen und etwa 15 Meter breiten Baracke, in der ich arbeitete, war ein kleiner, eiserner Ofen, der nur geheizt wurde, wenn Holzabfälle, altes, unbrauchbares Schuhwerk da war, oder wenn wir bei reiner Luft einer Kiste habhaft werden konnten.
Einmal freilich hatte letzteres für einen tschechischen Lehrer schlimme Folgen. Er hatte sich schon früher einmal sieben Tage Arrest zugezogen, weil er sich aus Abfällen Sockenhalter aus Draht angefertigt hatte. Nun wurde er bei der Zerkleinerung einer kleinen Kiste ertappt, und zwar von einem der schlimmsten Aufseher, der in solchen Fällen mit der Anzeige wegen Entwendung von Wehrmachtseigentum drohte.
Der arme Kerl bekam wieder eine Woche Arrest. Dieser bestand im Aufenthalt in einer ungeheizten Kellerzelle mit dünner Sommerkleidung und einer Decke auf bloßer Holzpritsche; Ernährung: Wasser und Brot. Da sich dieser Gefangene an seinem Arbeitsplatz dicht unterm Fenster in einer größeren Entfernung vom Ofen und im ständigen Gegenzug längst den Rheumatismus zugezogen hatte, musste er als Schwerkranker aus der Arrestzelle wiederkommen.
Er kam ins Krankenrevier. Was aus ihm wurde, konnte ich nicht mehr verfolgen. Aber es ging keiner gern in dieses Revier, dessen Arzt einmal zu kranken Gefangenen gesagt hatte: Ihr sollt ja verrecken. (...)
Beim Blindgängerkommando
Etwa 30 Zuchthausgefangene, meist Politische, viel Intelligenz und Ausländer, wurden in der näheren Umgebung Regensburg zur Ausgrabung und Entschärfung von Blindgängern verwendet. Obwohl ich in den ersten Tagen schon erfuhr, dass vor kurzem vier Leute aus diesem Kommando samt dem Aufseher bei einer Explosion ums Leben gekommen waren, und es so ein unbehagliches Gefühl war, an die Arbeitsstätte zu gehen, die mit der Tafel gekennzeichnet war: Vorsicht, Blindgänger, Lebensgefahr, (...) hätte ich nicht mehr mit dem Leben in Straubing getauscht. Die Arbeit in der frischen Luft wirkte belebend auf den abgestandenen Körper und brachte Entgiftung und Reinigung. (...)
Das Wertvollste aber war gerade in dieser Zeit die tägliche Begegnung mit dem Leben und dem Tagesgeschehen. Wenn es für uns noch eine Rettung gab, dann war es die Beschleunigung der bevorstehenden Katastrophe. Über all das war ich beim Kommando bestens unterrichtet. (...)
Wenige Wochen vor dem Ende arbeitete ich an der Grube auf einem Grundstück des Bürgermeisters in Unterriesling bei Regensburg. Gegen Mittag kam der Besitzer an unseren Arbeitsplatz. Gereizt grüßte er mit "Heil Hitler", was von uns nicht beachtet wurde. Der Gruß war uns Gefangenen übrigens verboten.
Dann fragte er den Aufseher, welche Leute er denn da bei sich hätte. Dieser zählte auf: Einen Professor, einen Bauern, einen Hotelbesitzer und einen Pfarrer. Darauf der Bürgermeister: "So, einen Pfarrer; das sind die, die uns am Sonntag immer die sauberen Judengeschichterln von der Kanzel herunter erzählen. Herrschaft, wenn ich könnte, wie ich möcht', selbst tät ich dich da in die Grube werfen und zuschaufeln." Das eisige Schweigen der Gruppe trieb ihn fort. (...)
Die letzten Tage: Tod oder Befreiung?
War die Frage, was mit den Leuten in meiner Lage werden wird, schon während all der vergangenen Jahre eine ständige, latente Beunruhigung, so bildete sie jetzt in den letzten entscheidungsvollen Tagen den Mittelpunkt aller Gespräche. Es gab nur eine zweifache Antwort: Tod oder Befreiung. Der Verstand rechnete mit dem Zeitgeschehen und dem Hass des untergehenden Verbrecherregimes, die Hoffnung und das Gottvertrauen entschied sich lieber für unvorhergesehene Möglichkeiten zu einer, wenn auch noch so unwahrscheinlichen Rettung.
Um 4 Uhr früh, am Mittwoch, den 25. April, wurden 5000 Gefangene im Hofe des Zuchthauses Straubing in Sechserreihen aufgestellt. (...) In Sträflingskleidern, ausgerüstet mit Essschüssel, Löffel und einer Decke, traten wir unter der Aufsicht von 200 Aufsehern, die mit Gewehren und Maschinenpistolen bewaffnet waren, unseren Elendsmarsch an.
Um 7 Uhr verließen wir den Bereich der düsteren Zwingburg, in Richtung Passau, hinein in einen strahlenden Frühlingsmorgen. Bald schwenkte der Zug in Richtung Landshut von der Passauer Straße ab. Zunächst wusste niemand um das Ziel, auch die Aufseher nicht. (...) Inspektor Todt dirigierte vom Fahrrad aus.
Gegen Mittag kreiste ein amerikanischer Flieger in geringer Höhe über uns, der erste Friedensbote und vielleicht unser Retter. Im Straßengraben lagen die Leichen von KZ-Häftlingen, die anscheinend bei einem früheren, ähnlichen Transport zusammengebrochen oder erschossen worden waren. (...) Gegen Abend hatte es sich herumgesprochen, dass wir nach Dachau geführt werden sollten.
SS erschießt die Schwachen
Am zweiten Tag brachen schon viele Leute zusammen und blieben im Graben liegen. Zum Teil wurden sie auf einen Wagen verladen und mitgenommen, zum Teil mit Prügeln übers Gesicht geschlagen und aufgetrieben. Kurz vor Landshut nächtigten wir wieder auf einer Wiese. Gegen 8 Uhr ertönte Panzeralarm. Alles geriet in Bewegung. Wir glaubten uns gerettet. Doch es blieb beim Alarm.
An diesem Tag hatte mir ein Aufseher im Vertrauen gesagt, dass wir zu einer Massenhinrichtung nach Dachau geführt würden und dass man dort auch die Aufseher aus dem Weg schaffen wollte, um keine Zeugen fürchten zu müssen. (...)
Am Freitag erreichten wir Moosburg. Die Schwäche steigerte sich, viele blieben liegen und wurden nun jetzt schon von SS-Patrouillen niedergeschossen. Der Hunger trieb die Leute dazu, in den Ortschaften, durch die wir zogen, die Hände aufzurecken und nach Brot zu schreien. Unter den Prügeln der Aufseher fielen sie über Futterrübenhaufen her und plünderten sie. (...)
Teilnahmslos trotteten wir durch die Straßen Moosburgs, als uns Straßenpassanten begeistert zuriefen: Der Krieg ist zu Ende. Die Regierung ist gestürzt. Wir erfuhren von den Vorgängen in München, von der Freiheitsaktion Bayern. Doch schon auf dem Weg nach Freising wurde unsere Hoffnung wieder jäh zerschlagen. (...)
Die Rettung naht
In Neustift bei Freising sah ich etwa 200 unserer Leute an den Straßengeländern und am Wegrand kauern,
lauter völlig erschöpfte Menschen. (...) Jetzt war die Frage Flucht oder Tod zur Frage des Augenblicks geworden; für die Flucht stand, dass bei dieser Gruppe - unser ganzer Zug war ein regelloser Haufen geworden - nur mehr ein Aufseher zurückgeblieben war, der obendrein keinen sehr furchterregenden Eindruck machte. Gegen die Flucht, dass wir nach den ersten Schritten von SS-Leuten, Soldaten oder Volksstürmlern, und es gab derer in Freising sehr viele, erschossen werden konnten.
Da kam ein günstiger Augenblick. Der Aufseher war eben in ein Haus getreten und die Straße zur nahe gelegenen Kirche ziemlich leer. So, gehen wir, nicht umschauen - einer sagte es, und wir gingen gemächlich fort. Keine Verfolgung, kein Schuss.
Auf halbem Weg schaute uns jemand nach, ohne uns zu verfolgen. Nachher erfuhren wir, dass dieser einer der
meist gefürchteten Fanatiker war. Als wir aus dem grau verhangenen Abend, aus dem Wind gepeitschten Regen in das herrliche Gotteshaus eintraten, vergaßen wir Gefahr und Elend, war es uns wie Kindern vor dem leuchtenden Christbaum. (...)
Es dauerte nicht lange, da hörten wir fernes Rollen, dann vereinzelt Schüsse. Wir gingen in den Keller. Nach dreistündiger Schießerei wurde die Stadt durch Stadtpfarrer Brey den Amerikanern übergeben.
Wir waren frei und außer Gefahr.
Karl Schuster
München, den 18. September 1946
Epilog II: Der deutsche Amerikaner
Dramatische Kindertage
Norman F. Weber ist stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Und er ist stolz darauf, Amerikaner zu sein. Inzwischen ist er beides, in seiner Kindheit konnte er weder das eine noch das andere sein. Der Methodisten-Pfarrer, der heute in Tennessee lebt, verbrachte das Kriegsende in Buchberg und in Wolfratshausen. Seine Familie musste ihre amerikanische Herkunft verbergen, um sich nicht in Gefahr zu bringen.
Der 71-jährige Norman F. Weber ist ein Zeitzeuge, wie ihn sich Historiker wünschen. Seine Erinnerungen an die Kriegsjahre im späteren Geretsried hören sich so lebendig an, als spielten sie gestern. Und sie klingen äußerst plausibel.
Ein paar Wochen ist es her, dass Weber beim Googeln im Internet auf diese Website gestoßen ist. Die Darstellung der NS-Geschichte Wolfratshausens und des Umlands wühlte in ihm viele Erinnerungen auf. Er trug sich ins Gästebuch ein, der Kontakt war hergestellt.
Neun Jahre ist Norman F. Weber alt, als der Zweite Weltkrieg endet: Er erlebt innerhalb weniger Wochen den amerikanischen Bombenangriff auf die Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst (9. April 1945), den Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge (30. April) und den Einmarsch der amerikanischen Truppen (1. Mai). Sieben Tage dauert es im Chaos des Zusammenbruchs, bis Mutter Änny sich mit ihren drei Kindern von Buchberg nach Wolfratshausen durchgeschlagen hat und dort Wohnung und Arbeit findet.
Die Geschichte Norman Webers hat viele Windungen, aber von Anfang an:
Zu Beginn der 30er-Jahre lernen sich Normans Eltern Änny Bauer und Frank Weber in New York kennen. Beide waren kurz zuvor eingewandert. Der Vater stammt aus einem kleinen Ort südwestlich von Berlin, die Mutter aus Penzberg. Im Sommer 1939, das Einbürgerungsverfahren läuft noch, kommt traurige Post aus Deutschland: Ännys Vater liegt im Sterben. Er wolle seine Familie noch einmal sehen, schreibt er, die Schiffspassage sei bezahlt. Die New Yorker gehen zurück in die Heimat – ohne eine Ahnung zu haben, dass sich dadurch alles für sie verändern wird.
Amerikaner Weber muss zur Wehrmacht
Eine Rückkehr nach Amerika ist nicht mehr möglich, denn am 1. September 1939 überfällt Deutschland Polen, der Zweite Weltkrieg bricht aus. Die USA sind nun, obwohl offiziell noch nicht im Krieg, ein Feindstaat. Frank Weber wird eingezogen und an die Ostfront geschickt – die amerikanische Staatsbürgerschaft, die er zwischenzeitig bekommen hatte, ist damit für ihn erledigt, zeitlebens.
Normans Mutter muss sich mit ihren beiden Kindern Norman und Lisa in Berlin allein durchschlagen. Als die Lage dort durch die fortgesetzten Bombenangriffe der Alliierten unerträglich wird, folgt sie 1943 ihrem Mann nach Przemysl in Polen. Aber auch dort wird es bald zu heiß: Die Rote Armee ist im Anmarsch, an den Geschützdonner kann sich Norman heute noch erinnern.
Die Webers flüchten erneut, diesmal nach Bayern, wo Ännys Schwester Elly mit ihrer Familie lebt. Genauer gesagt nach Buchberg, auf das Gelände der Rüstungsbetriebe. Normans Onkel Josef Lindner arbeitet dort als Direktor der IG Farben. Niemand außerhalb der Familie weiß, dass die Webers bis 1939 in New York gelebt hatten. Niemand weiß, dass die dort geborenen Norman und Lisa die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Sicherheitshalber hatte die Mutter alle verdächtigen Dokumente vernichtet. Nur die Geburtsurkunden ihrer Kinder behält sie und verwahrt sie an einem geheimen Ort.
An die Monate in Buchberg hat Weber schöne Erinnerungen. Die Familie wohnt in einem komfortablen Haus direkt an der Reichsstraße 11. Der Güterzug, mit dem Munition abtransportiert wird, bringt die Buben zur Schule nach Wolfratshausen. Mit seinem ein Jahr älteren Cousin Ekkehard genießt Norman unbeschwerte und freie Tage. Mit ein paar Einschnitten, die zeigen, dass der Krieg auch hier näherkommt:
Im Februar 1945 sollen die beiden Vettern für eine Woche in das Hochlandlager der Hitlerjugend, zur „Wehrertüchtigung“. Kurz darauf bekommt Normans Mutter die Aufforderung, ihren Sohn in die „Führerleitungsschule“ zu schicken. Vermutlich ist dies die Junkerschule in Bad Tölz, das heutige FlintCenter.
Norman geht nicht. Mutter und Tante haben Angst, dass man ihn dort behält. 62 Jahre danach erinnert sich Weber,
dass seine Mutter damals sagte, dass ihn diese Schule „verschluckt“ hätte.
In diesem Haus in Buchberg an der Reichsstraße 11 lebte Norman bis zum 30. April 1945.
Am 9. April beobachten Norman und Vetter Ekkehard aus der Tür des Bunkers (an der Straße nach Schweigwall) heraus den amerikanischen Luftangriff auf die Rüstungswerke. Er scheitert, treffen die über 5000 Bomben doch in die Schneise zwischen den Werken Geretsried und Gartenberg. Lediglich ein Arbeiter aus Königsdorf wird tödlich verletzt.
Lagerkommandant wird erschlagen
Dann kommt der 30. April 1945. Die Wachsoldaten flüchten, die in Lager Buchberg lebenden Zwangsarbeiter sind plötzlich frei.
Und die Amerikaner erlauben ihnen zu plündern und Rache zu nehmen. Ein oder auch zwei Tage herrschen Gesetzlosigkeit. Der Lagerkommandant, „ein einarmiger Mann“, so erinnert sich Norman, wird von befreiten Zwangsarbeitern erschlagen.
Steine fliegen in die Fenster. Die Familien Lindner und Weber müssen alle ihre Vorräte hergeben. Sie fürchten um ihr Leben. Ein paar Habseligkeiten laden sie in den Kinderwagen von Normans zwei Monate alter Schwester Helga
und versuchen sich nach Wolfratshausen durchzuschlagen.
Norman F. Weber erinnert sich an die dramatischen Erlebnisse Anfang Mai 1945:
„Wir sind erst durch den Wald hinter unserem Haus, aber man hat auf uns geschossen. Wir laufen so schnell wie möglich auf die Straße, um Amerikaner zu finden. Man beschimpft uns: ,Ihr deutschen Schweine.‘ Und noch Böseres. Plötzlich umkreisten uns eine Menge Männer und verlangten das, was im Babywagen ist. Erst weigerte sich Mutter. Dann griff ein Mann mich und hielt ein langes Messer unter mein Kinn, mit der Drohung, er werde zustechen, wenn meine Mutter die Sachen nicht hergibt.“
Eine Woche brauchen die beiden Familien für die fünf Kilometer zum Lager Föhrenwald. Ein US-Soldat steht am Tor. Normans Mutter läuft ihm entgegen, hält ihm die Geburtsurkunden der Kinder hin, spricht ihn auf englisch an. Gerettet!
Zwei Tage lang kommen die beiden Familien im Lager Föhrenwald unter: Die Zwangsarbeiter der Rüstungswerke sind schon weg, die später bis zu 6000 heimatlosen Juden (offiziell: DPs, Displaces Persons) noch nicht da. Mutter Weber ist bei der Militärregierung äußerst willkommen. Sie spricht perfekt englisch, sie kennt die amerikanische Mentalität.
Das „Military Gouvernement of America“ versucht aus dem Chaos heraus neue Strukturen aufzubauen. Zwischen 19 und 6 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Und für die Soldaten werden zahlreiche Häuser beschlagnahmt, die Bewohner müssen schauen, wo sie unterkommen – und zwar „as soon as possible“, so schnell wie möglich.
Davon profitieren die Webers. Ihnen werden ein paar Zimmer im Spatz-Haus an der Ludwig-Thoma-Straße zugewiesen, dem Anwesen einer jüdischen Viehhändler-Familie, die von den Nazis zum größten Teil deportiert und umgebracht wurde.
Erstkommunion feierte Norman (li.) 1946 in Wolfratshausen.
Captain Bischoff, Änny Weber und die Büromädels
Captain Carl H. Bischoff trägt mit sechs weiteren amerikanischen Offizieren und einer ganzen Reihe „amerikanischer Büromädel“ (so erinnerte sich später Gemeindesekretär Anton Geiger) die Verantwortung. Sie beziehen Quartier im Amtsgericht, dem heutigen Heimatmuseum.
Bürgermeister Hans Winibald, 1933 von den Nazis des Amtes enthoben, wird wieder eingesetzt. Nochmals Anton Geiger:
„Eigentlich waren unsere Besatzer recht großzügig. Mit der Zeit hat man sich sogar angefreundet. Der erste Bürgermeister Hans Winibald fand bei den Amerikanern immer ein offenes Ohr.“
Daran hat das Ehepaar Weber auch seinen Anteil. Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945 bekommt auch Frank Weber eine Stelle als Dolmetscher. Dank der engen Beziehungen zur US-Army bekommen die Webers in diesen Notzeiten mehr und bessere Lebensmittel als die einheimische Bevölkerung.
Mit 15 Jahren darf Norman den Führerschein machen. Er wird gebraucht: Für den Vater fährt er immer wieder als Bote ins amerikanische Hauptquartier, die Flint-Kaserne nach Bad Tölz. Eine Stadt, zu der er auch enge familiäre Bindungen hat, wie er Jahrzehnte später erfährt: Sein Großvater gehörte zu den Erbauern der evangelischen Kirche in der Schützenstraße und des Café am Wald.
Als die Amerikaner die Macht in zivile (deutsche) Hände übergeben, ziehen die Webers nach Chieming und ein Jahr später nach München. Norman, inzwischen 18, besinnt sich 1954 seiner amerikanischen Wurzeln, tritt der US-Army bei und kommt nach Kentucky, in sein Heimatland. Heimatland? Nur zwei Jahre später lässt er sich nach Deutschland versetzen, bis 1959 ist er in Augsburg stationiert.
Der Vater muss bleiben. Er ist staatenlos und bekommt einen Ausweis als Flüchtlinge (DP-Pass). Beide Schwestern von Norman Weber wandern ebenfalls in die USA aus. Nach dem Tod ihres Mannes 1972 zieht Mutter Änny zu ihrer Tochter Helga.
Norman F. Weber (mit Ehefrau Sandy) lebt heute als Ruhestands-Pfarrer in Mount Juliett/ Tennessee.
Weber besucht Deutschland jedes Jahr
Norman Weber, der noch in seiner Militärzeit geheiratet hat, geht 1959 nach seinem Abschied aus der Armee
zum Studium nach Tennessee. Er bekommt einen gut dotierten Posten bei einer Kraftfutterfirma (die ihn für drei Jahre nach Krefeld schickt). Die Webers haben zwei Kinder (heute 42 und 40). Er macht sich selbstständig, und mit 48 Jahren sattelt er noch einmal um und wird Pfarrer in der methodistischen Kirche.
Die Verbindungen zu Deutschland sind bis heute intensiv, nicht nur wegen der zahlreichen Verwandten seiner Eltern
und nicht nur weil die Webers (nach dem Tod seiner Frau hat er wieder geheiratet) fast jedes Jahr über den großen Teich kommen.
2002 war er zuletzt in Wolfratshausen, 2004 in Bad Tölz, 2010 will er wiederkommen. Dieses Jahr war er auf den Spuren der Reformation in Norddeutschland und der Schweiz. Bis heute hält Norman Weber immer wieder Vorträge über Deutschland, in Schulen und vor Veteranenverbänden. „Ihr habt auf mich geschossen“, sagt er dann und erzählt,
wie das damals war – in Buchberg und in Wolfratshausen, als die Amerikaner kamen.
Dieser Artikel erschien am 10. August 2007 im Tölzer Kurier
Quellen und Dank
Stadtarchiv Wolfratshausen
Stadtarchiv Geretsried
Staatsarchiv München
Pfarrarchiv Wolfratshausen
Gemeindearchiv Dietramszell
Aufzeichnungen und Dokumente von Pfarrer Ulrich Wimmer
Wolfratshauser Wochenblatt
Wolfratshauser Tagblatt; auch Auswertungen von Max Roderer
Loisach-Isar-Bote
Isar-Loisachbote
Tölzer Zeitung
Tölzer Kurier
Quirin Beer: "Chronik der Stadt Wolfratshausen" (1986, Stadtarchiv Wolfratshausen)
Gemeindechronik Königsdorf (Gemeinde Königsdorf)
Heimatbuch Dorfen (Gemeinde Icking)
Paul Brauner u.a.: "Chronik der Kolpingsfamilie Wolfratshausen" (1965,
Stadtarchiv Wolfratshausen)
Christoph Schnitzer: "Die NS-Zeit im Altlandkreis Bad Tölz" (1995,
2. Auflage 2005, beim Autor per Mail oder im Internet
Franz Buchner: "Kamerad! Halt aus!" (1938, Staatsarchiv München)
Andreas Stumpf: "Heimat- und Familienforschung" (1950, Stadtarchiv Wolfratshausen)
Sebb, Gritzmann u. a.: "Beiträge zur Geschichte Geretsrieds" (1990, Stadtarchiv Geretsried)
Prof. Dr. Johannes Preuß u. a.: "Rekonstruktion der ehemaligen Rüstungsbetriebe Geretsried" (1992, Stadtarchiv Geretsried)
Josef Reiss, Eugen Steppan: "Waldram" (1982, Stadtarchiv Wolfratshausen)
Guido Reiner: "Ernst Wiechert im Dritten Reich" (1974, vergriffen)
Friedrich Hitzer: "Vom Ende und vom Anfang des Zweiten Weltkrieges"
(1985, Broschüre Eigenverlag, vergriffen)
Andreas Wagner: "Todesmarsch" (1995, vergriffen, im Internet)
Fritz Baer: "Das dramatische Ende" (Stadtarchiv Wolfratshausen)
Heinrich Pflanz: "Das Internierungslager Moosburg 1945 bis 1948" (1992,
Eigenverlag vergriffen)
Ulrich Müller: "Die Internierungslager in und um Ludwigsburg" (vergriffen, Stadtarchiv Ludwigsburg)
Bericht von Kooperator Karl Schuster (Stadtarchiv Wolfratshausen)
Angelika Schardt: "Der Rest der Geretteten" (Magisterarbeit, 1990, Stadtarchiv Wolfratshausen)
Angelika Königseder/Juliane Wetzel "Lebensmut im Wartesaal"
(1994/Neuauflage 2005, Fischer Taschenbuch)
Gerhard Lauer: "Die verspätete Revolution: Erich von Kahler" (1995, erhältlich nur noch im englischen Original)
Allan Bullock: "Hitler" (Erstausgabe 1953, vergriffen, antiquarisch erhältlich)
Dank
Ohne Unterstützung vieler interessierter Menschen wäre dieses Buch nicht denkbar gewesen.
Ich danke darum Marianne Balder, die mir als Leiterin des Stadtarchivs Wolfratshausen mit großem Engagement
und auch Vertrauen alle notwendigen Akten zugänglich machte.
Mein großer Dank gilt auch Pfarrer Ulrich Wimmer, dessen heimatgeschichtliche Forschungen in den 50er und 60er Jahren gar nicht entsprechend gewürdigt werden können.
Auch Krista Maurer, die Leiterin des Stadtarchivs Geretsried, zeigte sich bei allen Anfragen kooperativ. Danke dafür.
Der Dank an Franz Bäumler und Fritz Bauereis soll hier stellvertretend stehen für die vielen Zeitzeugen, die mir Geschichten aus ihrer Jugendzeit erzählt haben.
Gewidmet habe ich dieses Buch meinen Kindern Ines (geb. 1987), Jonas (geb. 1989) und Felix (geb. 1991)
Joachim Braun
Wolfratshausen, im November 1995
Die Autoren
Joachim Braun, 30, verbrachte die ersten Lebensjahre in Lüneburg und seine Jugendzeit in Bad Tölz, wo er 1984 auch das Abitur ablegte. Nach einer lehrreichen Zwischenstation bei einem Anzeigenblatt volontierte er 1986/87 beim "Tölzer Kurier". Nach einem erneuten Gastspiel bei einer Wochenzeitung wechselte er im Juli 1989 nach Wolfratshausen zum "Isar-Loisachboten". Dort ist er seit vier Jahren stellvertretender Redaktionsleiter.
[Nachtrag
2018: Für "Ende und Neubeginn" bekam Braun 1996 einen Sonderpreis beim Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung verliehen. Von 1997 bis 2011 war er Redaktionsleiter des "Tölzer Kurier", anschließend fünf Jahre Chefredakteur des Nordbayerischen Kurier in Bayreuth und gut zwei Jahre in derselben Position bei der "Frankfurter Neuen Presse".]
Holger Eichele, 22, Autor des Kapitels "Sinnloses Inferno" ist Redakteur beim "Isar-Loisachboten". Er ist in Starnberg geboren, in Wolfratshausen aufgewachsen, hat in Icking das Gymnasium besucht und bei den "Schongauer Nachrichten" und beim "Isar-Loisachboten".
[Nachtrag
2018: Eichele war bis 2003 als Nachfolger Brauns stellvertretender Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten und anschließend Berlin-Korrespondent der Zeitungsgruppe Münchner Merkur. 2009 wurde er Pressesprecherin von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner. Seit Ende 2013 ist er Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbunds.]
Andreas Salch, 33, Mitarbeiter beim Kapitel "Hauptsache Arier" hat an der Uni München Geschichte studiert und ist gegenwärtig Volontär beim "Isar-Loisachboten". Er lebt in München.
[Nachtrag
2018: Salch arbeitet als freier Mitarbeiter/Reporter für die Süddeutsche Zeitung in München.]
Andreas Höger, 26, Autor des Kapitels "Dorf im Krieg" studiert Geschichte an der Uni München. Vor seinem Studium absolvierte er ein Volontariat beim "Isar-Loisachboten", für den er seit Jahren die Gemeinde Egling betreut.
Der gebürtige Eglinger wohnt mit seiner Familie in Baiernrain.
[Nachtrag
2018: Höger war bis Ende 2005 Redakteur des Tölzer Kurier, zuständig für den Isarwinkel. Seit 2006 ist er Redakteur des Holzkirchner Merkur.]
Hans Rieger, Mitarbeiter beim Kapitel "Die Fahne heraus", arbeitet bei der Gemeindeverwaltung Egling und ist nebenbei
als freier Mitarbeiter für den "Isar-Loisachboten" tätig. Seine Spezialthemen sind kirchliches Brauchtum und Heimatgeschichte.